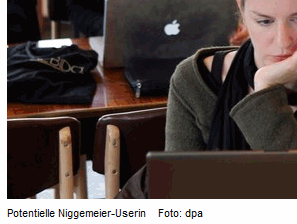(Wär natürlich auch was für die Kategorie „Super-Selbstreferentialität“.)
Callactive GmbH ./. Niggemeier II
Das Landgericht Hamburg hat gestern eine einstweilige Verfügung bestätigt, die die Firma Callactive, die für MTV zweifelhafte Anrufsendungen produziert, am 3. September 2007 gegen mich erwirkt hat. Darin wird mir verboten, eine Äußerung zu verbreiten oder verbreiten zu lassen, die ein Unbekannter am 12. August 2007 in einem Kommentar unter diesem Eintrag in meinem Blog gemacht hat. Dass dieser Kommentar unzulässig war, ist unstrittig. Die juristische Auseinandersetzung dreht sich im Kern darum, ob ich meinen Pflichten als Verantwortlicher dieser Seiten nachgekommen bin. Der Kommentar wurde in der Nacht zum Sonntag um 3.37 Uhr abgegeben. Ich habe ihn (wie berichtet) sofort und unaufgefordert gelöscht, als ich ihn gesehen habe; das war am Sonntagmorgen um 11.06 Uhr. Nach Ansicht des Hamburger Landgerichts genügte das nicht. Ich hätte die Kommentare vorab kontrollieren müssen.
Die Argumentation der Gegenseite
Im Antrag zum Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen mich beziehen sich die Anwälte von Callactive darauf, dass der Betreiber einer Internetseite immer dann für Äußerungen Dritter hafte, wenn er seine Prüfpflichten verletzt habe. Ich hätte „schon durch die Bereitstellung und das Betreiben des Forums [sic!]“ die Gefahr heraufbeschworen, dass Leser sich „ehrverletzend“ äußern. Bereits durch die „Brisanz des Ursprungsartikels“ hätte ich „vorhersehbar rechtswidrige Beiträge Dritter provoziert“ und „durch die Anfügung der Rubrik ‚Kommentare‘ Dritte geradezu dazu aufgerufen, sich zu äußern“. Zudem sei offenkundig, dass es mir nicht um eine sachliche Auseinandersetzung mit Callactive gehe, sondern um „plakative Vorwürfe und Verleumdungen“. Das zeigten schon die Titel meiner Blog-Einträge (zum Beispiel dieser, dieser, dieser, dieser und dieser).
Unter diesen Voraussetzungen sei ich verpflichtet, Kommentare vorab zu kontrollieren. Nur so könne ich sicherstellen, dass durch mein Blog keine Rechte Dritter verletzt würden.
Unsere Argumentation
Im Widerspruch zur Einstweiligen Verfügung betont mein Anwalt, dass mein Beitrag „Call-TV-Mimeusen“ sich kritisch, aber sachlich mit Callactive auseinandersetze: „Der Beitrag selbst ist weder rechtsverletzend, noch ruft er – direkt oder indirekt – zu Rechtsverletzungen auf.“ Ich erfülle alle Prüfungspflichten „über Gebühr“, indem ich die Kommentare mehrmals täglich prüfe, bei längerer Abwesenheit die Kommentarfunktion teilweise abschalte und Kommentare von Nutzern, die bereits auffällig geworden sind, filtere.
Mein Anwalt verweist u.a. auf das Landgericht Düsseldorf, das in einem ähnlichen Fall urteilte, dass es keinen Anspruch auf die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gebe, wenn der Anbieter eines Forums die umstrittenen Äußerungen unverzüglich entfernt hat. Auch der Forderung des Bundesgerichtshofes, dass Dienstanbieter gegebenenfalls Vorsorge dafür treffen zu müssen, dass sich einmal aufgetretene Rechtsverletzungen möglichst nicht wiederholen, komme ich nach.
Die Meinung des Gerichts
Die schriftliche Urteilsbegründung liegt mir noch nicht vor, deshalb sind die folgenden Ausführungen ausschließlich meine Interpretation des Verlaufs der mündlichen Verhandlung am vergangenen Freitag.
Nach Ansicht der Richter hätte ich mit rechtswidrigen Kommentaren zu meinem Eintrag „Call-TV-Mimeusen“ rechnen müssen. Das ergebe sich aus seiner Brisanz und zeige sich auch darin, dass schon vor dem Kommentar, den ich entfernt habe, eine Reihe Kommentare abgegeben wurden, die an der Grenze zu Rechtsverstößen seien, wenn nicht darüber hinaus. Bei solch brisanten Blog-Einträgen sei ich dazu verpflichtet, die Kommentare vorab zu kontrollieren, insbesondere, da ich anonyme Kommentare unter Pseudonym zuließe.
Die Richter gestanden mir zu, vieles richtig gemacht und schnell reagiert zu haben. Das spiegle sich auch in dem niedrigen Streitwert von 6000 Euro wieder. Sie schlugen zudem einen Vergleich vor, wonach ich die geforderte Unterlassungserklärung abgebe, aber nicht die Kosten der Gegenseite tragen muss.
Mein Kommentar
Ich habe den Vergleich abgelehnt, weil es für mich tatsächlich, wie das Gericht mit Bedauern feststellte, ums Prinzip geht. Einen zwingenden Verzicht auf eine offene Kommentarmöglichkeit bei brisanten Einträgen kann ich aus mehreren Gründen nicht akzeptieren:
Ich finde den Gedanken schwer erträglich, dass mein Beitrag die Ursache dafür sei, dass Menschen sich provoziert fühlen, sich in unzulässiger Weise über Callactive zu äußern, und nicht das Geschäftsgebaren von Callactive selbst. Nach der Argumentation des Gerichts könnte man kritischen Journalismus per se als gefährlich werten, weil er die Menschen zu negativen Meinungsäußerungen über das animieren könnte, was er aufdeckt oder anprangert.
Das Gericht sagt, ich müsse nur bei solch brisanten Einträgen die Kommentare vorab kontrollieren, nicht bei harmlosen Themen. Diese Unterscheidung halte ich nicht nur für falsch, weil sie eine öffentliche Debatte gerade über wichtige Dinge erschwert, sondern auch für außerordentlich weltfremd: Erstens wird eine Abgrenzung, welches Thema so brisant ist, dass eine freie Kommentarfunktion sich verbietet, und welches nicht, in der Praxis kaum möglich sein. Und zweitens kann jemand, der zum Beispiel den Callactive-Geschäftsführer in meinem Blog beleidigen will, aber durch die Vorabkontrolle unter einem Eintrag zum Thema Callactive daran gehindert wird, einfach unter einem vermeintlich harmlosen Eintrag kommentieren.
Ein Unternehmen, mit dem sich ein Blog oder ein Forum kritisch auseinandersetzt, könnte nach dieser Rechtsprechung des Hamburger Landgerichts die Schließung der Kommentare auch einfach selbst herbeiführen: Es müsste nur selbst anonym oder unter falschem Namen einen unzulässigen Kommentar abgeben und könnte dann gegen den Betreiber der Seite juristisch vorgehen.
Ein Richter hat mir in der Verhandlung Vorschläge gemacht, wie trotzdem in den Kommentaren eines Blogs eine Konversation über ein heikles Thema entstehen könnte: Ich könnte mich doch zum Beispiel einen Nachmittag zwei, drei Stunden hinsetzen und mich ganz darauf konzentrieren, die Kommentare zu moderieren. Sie würden dann alle vorab von mir geprüft und trotzdem in schneller Folge erscheinen, so dass die Menschen aufeinander Bezug nehmen können.
Der Richter betonte, ich hätte auch deshalb verschärfte Prüfungspflichten, weil ich Kommentare unter Pseudonym zuließe. Mal abgesehen davon, dass im Kommentarfeld dieses Blogs die Eingabe von Namen und E-Mail-Adresse als Pflicht gekennzeichnet ist, wüsste ich nicht, wie ich das ändern könnte. Wie könnte ich in der Praxis, wenn ich es wollte, sicherstellen, dass nur Leute unter ihrem richtigen Namen bei mir kommentieren?
Es ist, wenn man sich viel im Internet bewegt, eine sehr fremde Welt, in die man eintaucht, wenn man sich mit den einschlägigen Entscheidungen des Hamburger Landgerichts beschäftigt. Es ist auch eine Welt, in der man das Recht auf freie Meinungsäußerung nicht als eine der größten Errungenschaften zu sehen scheint, sondern als eine ständige Bedrohung, die bislang zum Glück eher theoretischer Natur war, seit dem Siegeszug des Internets aber ganz praktisch täglich bekämpft werden muss. Es kam mir am Freitag im Gerichtssaal vor, als schwebe über der ganzen Verhandlung unausgesprochen die Frage, warum es das überhaupt geben muss: die Möglichkeit für jedermann, Kommentare abzugeben — wir sind doch bislang auch ganz gut ohne ausgekommen. Ich konnte nicht aufhören, mir vorzustellen, wie die Richter vor 50 Jahren entschieden hätten, wenn es um irgendwelche unzulässigen Fernsehbilder gegangen wäre, und ob sie auch der Meinung gewesen wären, man könnte auf dieses neumodische Bilderzeug gut verzichten, schließlich habe sich das Radio als Medium gut bewährt.
Ich glaube nach wie vor: Würde sich das Rechtsverständnis des Hamburger Landgerichts, wie es sich in vielen Entscheidungen zeigt, durchsetzen, wäre das das Ende der offenen Diskussion in Foren, Blogs und Online-Medien. Denn das Risiko, ein Forum oder ein Blog zu betreiben, das sich in irgendeiner Form mit heiklen Themen oder dubiosen Geschäftspraktiken befasst, wäre viel zu groß.
Ich werde Berufung gegen dieses Urteil einlegen.
[Falls Sie sich wundern, warum die Kommentare unter diesem Eintrag geschlossen sind, lesen Sie ihn bitte noch einmal.]
Weiterführende Links:
- Kurt Sagatz kommentiert die Entscheidung auf tagesspiegel.de.
- Malte macht sich im Spreeblick „in aller dem Urteil angemessenen Willkür“ ein paar lose Gedanken.
- Frank Patalong gibt bei Spiegel Online einen ausführlichen und außerordentlich lesenswerten Überblick über die widersprüchlichen Urteile über zur Forenhaftung in Deutschland.
- Klaus Raab berichtet in der „taz“ und zitiert den Urheberrechtsexperten Winfried Bullinger mit den Worten: „Die Vorabprüfungspflicht für Kommentare würde das Medium Blog ad absurdum führen“
- Lukas grübelt bei „Coffee And TV“ über Haltbarkeit und Verbreitung des Internets.
- Meldung auf heise online.
- Der „Tagesspiegel“ fragt nach den Konsequenzen des Urteils.
- gulli.com warnt vor Panik.
- Und im Call-in-TV-Forum kann man (moderiert) über das Urteil diskutieren.
Pressevielfalt

Medien im Blutrausch (upd.)
Ich bin gespannt, ob irgendjemand von „Panorama“, „Hart aber Fair“, „Kontraste“ oder „Frontal 21“ zumindest den Versuch unternehmen wird, Matthias Dittmayer den Glauben an das Gute im deutschen Fernsehjournalismus wieder zu geben, und ersthaft Stellung nimmt zu dieser Anklage von ihm:
Ich habe die Richtigkeit von Dittmayers Aussagen nicht überprüft, aber seine Argumentation ist beeindruckend und allemal überzeugender als die ahnungslosen, berufsempörten Gesichter und Floskeln der gezeigten Protagonisten.
Und ich kann es nicht fassen, dass in Großbritannien zum Beispiel eine breite Diskussion stattfindet über Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit in den Medien, die sogar dazu führt, dass die „Noddys“ in Frage gestellt werden, die Gegenschüsse auf nickende Fragesteller, die nachträglich gedreht und in Fernsehinterviews geschnitten werden, und bei uns kann die Redaktion von „Kontraste“ einfach die Kritiker blöde anpöbeln und der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Jobst Plog, kann in einer Erklärung sinngemäß sagen: Klar haben wir die lachenden Gesichter von zwei Leuten einfach hinter eine Szene geschnitten, über die sie in Wahrheit gar nicht lachen, das machen wir immer so, na und? Und das vermeintliche Kontrollorgan, der Rundfunkrat, sagt dann: Wenn der Intendant das so sagt? Und es bricht kein Sturm der Entrüstung los und keine breite Debatte über den Zustand des öffentlich rechtlichen Vorzeigefernsehjournalismus und stattdessen reden wir über das Nazometer von Schmidt & Pocher? Im Ernst?
[via Medienlese, via jetzt.de]
Nachtrag, 30. November: Claus Richter, Redaktionsleiter des ZDF-Magazins „Frontal 21“, weist in einer ausführlichen Stellungnahme (pdf) die Vorwürfe als „gänzlich unbelegt, nicht stichhaltig oder irreführend“ zurück. Zum Vergleich: Dittmayers detaillierte Auseinandersetzung mit dem „Frontal 21“-Beitrag steht hier.
Nachtrag, 4. Dezember: Chris Winkler nimmt auf d-frag.de die Stellungnahme von „Frontal 21“ auseinander und urteilt: „(…) noch immer fehlt der zuständigen Redaktion die Einsicht, was damals schief gelaufen ist und womit sie die wütenden Reaktionen eigentlich provoziert hat. (…) die jetzige Stellungnahme [offenbart] erschreckend viel Unkenntnis gepaart mit unerschütterlichem Glauben an die eigene Unfehlbarkeit.“
Forever Wrong
Gibt es eigentlich Untersuchungen darüber, ob Falschmeldungen eine längere Lebenserwartung haben als richtige? Dafür spräche nicht irgendeine komplizierte Variante von Murphy’s Law, sondern auch die Tatsache, dass manche Fehler nicht nur zufällig gemacht und weitergetragen werden, sondern auch deshalb, weil sie bestimmte Vorurteile viel besser zu bestätigen scheinen als die Wahrheit.
So würde ich mir zum Beispiel (die Älteren außer Hobbyschaffner Siegfried Weischenberg werden sich erinnern) die außerordentliche Langlebigkeit der Mär erklären, dass man es mit 450 Lesern im Monat unter die 100 meistgelesenen deutschen Blogs schaffe.
Das träfe auch bei der irrigen Annahme zu, dass die Zahl der Fremdwörter im Deutschen so rasant zugenommen habe, dass heute 23 der 100 am häufigsten verwendeten Begriffe englisch seien — im Vergleich zu einem einzigen 1985. In Wahrheit betrifft das nur die am häufigsten verwendeten Begriffe in der Werbung [pdf].
Die Karriere dieser Falschmeldung ist eindrucksvoll: Die „New York Times“ berichtete korrekt über die deutsche Studie, der „Focus“ schrieb sie dort falsch ab, der „Spiegel“ übernahm den Fehler (und sah sich außer Stande, ihn zu berichtigen), die „Bild“ übernahm den Fehler — und nun steht der Unsinn in „Geo Wissen“, weil Walter Krämer ihn in seinem Fremdworthass für plausibel hält und aus dem „Spiegel“ zitiert.
Das ist besonders blöd, weil Krämer sonst womöglich ein guter Experte wäre, um meine Eingangsfrage zu beantworten. Er ist nämlich Autor der Lexika der populären Irrtümer.
[via Wortistik, natürlich]
Wahrheit hilft
Ivy
John Sweeney war ein angesehener Journalist in Großbritannien. Einmal hatte er sich in Zimbabwe im Kofferraum eines Autos versteckt, um den Oppositionsführer treffen zu können; er war ausgezeichnet für Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Algerien, im Kosovo, in Tschetschenien. Und nun gab es diese Filmaufnahmen: Wie er einen Pressemenschen von Scientology anschreit. Wie er die Kontrolle über sich in einem Maße verliert, das alles in Nachmittagstalkshows gesehene übersteigt, und mit hochrotem Kopf und sich überschlagender Stimme brüllt und brüllt und brüllt.
Scientology selbst hatte das Video gemacht, als Sweeney für die BBC eine Dokumentation über die Organisation drehte, und brachte es nun in die Öffentlichkeit. Der Auftritt des Journalisten wirkt auf den Bildern so abstoßend, dass die BBC eigentlich mit allen Mitteln dafür sorgen müssen, dass so wenige ihrer Zuschauer wie möglich sie sehen. Stattdessen zeigte sie sie selbst.
Sie brachte sie in der Dokumentation, verlinkte von ihren Internetseiten auf den Scientology-Ausschnitt, diskutierte den Vorfall ausführlich. Sweeney versuchte, sich zu erklären und zu entschuldigen, und sein Redakteur erklärte: „Ich bin sehr enttäuscht von Sweeney.“ Dadurch, dass der Sender selbst über den Fall berichtete, konnte er ihn im Kontext darstellen und seine eigene Sicht der Dinge hinzufügen. Vor allem aber hatte die BBC erkannt, dass das Schlimmste für sie nicht wäre, wenn viele Zuschauer die Aufnahmen ihres ausrastenden Journalisten sehen würden. Das Schlimmste wäre es, wenn die Zuschauer das Gefühl hätten, die BBC würde versuchen, diese Aufnahmen vor ihnen zu verstecken und den Fall kleinzureden.
Diese Logik gilt nicht nur im Verhältnis von Medien zu ihrem Publikum. Sie gilt generell. Es geht um Vertrauen. Die meisten Menschen werden akzeptieren, dass Fehler passieren. Die wenigsten werden akzeptieren, dass diese Fehler vertuscht werden.
Das klingt so banal, dass man es kaum hinschreiben mag. Und bestimmt doch so wenig das Handeln von Unternehmen.
Wie aus einem relativ überschaubaren Problem eine unkontrollierbare Krise wird, weil die Reaktion als Versuch gesehen wird, unangenehme Wahrheiten zu verbergen, dafür gibt es viele Beispiele – jüngst die Störfälle in den Atomkraftwerken von Vattenfall. Dass in deren Folge der Deutschlandchef gehen mussten lag nicht an den technischen, sondern an den kommunikativen Pannen. Die fehlende Transparenz war eine einzige misstrauensbildende Maßnahme. Inzwischen stellt Vattenfall nach eigenen Angaben alle Informationen über die Störfälle umgehend ins Internet. Das ist ein bisschen spät.
Die meisten Experten für Krisenkommunikation sind sich einig, was ein Unternehmen tun sollte, wenn etwas schief läuft: schnell, umfassend und transparent informieren. Doch bei den Verantwortlichen scheint die Sorge um den Vertrauensverlust durch mangelnde Offenheit immer noch kleiner als die, schlafende Hunde zu wecken und Kunden durch die eigene Kommunikation überhaupt erst darauf aufmerksam zu machen, dass etwas schief gegangen ist.
Dabei spricht vieles dafür, dass sich durch Transparenz und die Demonstration des eigenen Verantwortungsbewusstseins die negativen Wirkungen von Pannen nicht nur ausgleichen, sondern mehr als wettmachen lässt. Am eindrucksvollsten zeigte das der Pharmariese Johnson & Johnson, als im Herbst 1982 in Chicago mehrere Menschen starben, die vergiftete Schmerztabletten der Marke Tylenol eingenommen hatten. Obwohl es sich um eine kriminelle Manipulation und nicht um einen eigenen Fehler handelte, sah sich der Hersteller in der Verantwortung, warnte in Anzeigen vor dem Konsum jeglicher Tylenol-Produkte und tauschte in einer gewaltigen Rückrufaktion landesweit Tabletten im Wert von 100 Millionen Dollar aus. Rechtlich bestand dazu keine Notwendigkeit, und viele Beobachter glaubten, dass danach die Marke Tylenol tot sein würde. Doch als Johnson & Johnson das Produkt einige Monate später in neuer, sichererer Form auf den Markt brachte, zahlte sich die offensive Offenheit aus: Die drastischen Maßnahmen hatten das Vertrauen der Kunden in die Marke gestärkt: Sie machten Tylenol wieder zum Marktführer.
Das ist jetzt 25 Jahre her, und scheint die Manager in Deutschland wenig beeindruckt zu haben. Freimütig Fehler einzuräumen, das ist für die meisten immer noch undenkbar. Der Reflex lautet: Das stimmt gar nicht, das ist gar nicht so schlimm, das war nicht unsere Schuld.
Und natürlich ist es schwer, eine umfassende Rechnung aufzumachen, wann sich die Transparenz für ein Unternehmen lohnt. Wann es nicht nur ethisch gut ist, eigenes Fehlverhalten offenzulegen, sondern nützlich. Die Folgen gescheiterter Vertuschungsstrategien sind dramatisch, aber wie oft hat sich die Vertuschung ausgezahlt, weil sie erfolgreich war und die breite Öffentlichkeit nicht von einem Skandal oder seinen wahren Ausmaßen erfuhr? Und wie groß ist die Gefahr, dass das Publikum die eigene Offenheit nicht würdigt, sondern nur den Fehler sieht im Vergleich zu Konkurrenten, bei denen es keinen Fehler sieht?
Dennoch spricht im digitalen Zeitalter immer mehr für eine aufrichtige Kommunikation mit den Menschen. Weil unliebsame Informationen plötzlich – ohne Filter durch die Medien – aus allen Richtungen kommen können und sich immer weniger unterdrücken lassen. Und weil das Internet jedem die Möglichkeit bietet, direkt mit seiner „Zielgruppe“ zu kommunizieren. Schon 1999 forderte das von Internet-Vordenkern verfasste „Cluetrain Manifest“, mit Menschen wie mit Menschen zu reden. Doch auch acht Jahre später ist es immer noch eine kleine Sensation, wenn Kirstin Walther, Geschäftsführerin der gleichnamigen Kelterei, in ihrem Saftblog offenherzig von den Pannen erzählt, wie der, als ein Kunde auf der Tüte in seinem Getränkekarton einen handgeschriebenen Aufkleber fand: „Ich bin der 475. Beutel! Ist der Rotz bald mal alle!“
Andererseits: Solange Transparenz noch so rar ist, müsste sie sich für jedes Unternehmen doppelt lohnen.
Wie saul ist Kai Diekmann?
Bei der „taz“ gibt es ein Pro und Contra zur Zusammenarbeit einiger großer Umweltverbände mit „Bild“, und Marlehn Thieme, Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung, argumentiert dafür:
Darf man sich als kritische Organisation mit einem Massenblatt einlassen, das bislang nicht gerade als Umweltschützer aufgetreten war? Manche Kritiker erinnerten an die Anti-Ökosteuer-Stimmungsmache der Zeitung: „Ökosteuer? – Ich hup euch was“. Kann der Feind wirklich zum Freund werden?
Ich meine ja. Es ist gut, wenn Saulus zum Paulus wird, gerade wenn es bequemer wäre, im eigenen Saft zu schmoren. Auch dem „Meinungsgegner“ muss man einen Gesinnungswandel zugestehen. Der Grundsatz „in dubio pro reo“, im Zweifel für den Angeklagten muss auch für die gelten, an deren Motivation manche zweifeln — und verborgene Hintergedanken wittern. Das gilt auch für Medien wie die Bild-Zeitung. (…)
Aber wenn die Bild-Zeitung ihre Leser dazu auffordert, das Klima zu schützen, dazu beizutragen, dass Energie gespart wird, dass nachhaltiger mit Ressourcen umgegangen wird, dass darüber nachgedacht wird, ob der nächste Urlaub wirklich mit dem Flieger gemacht werden muss – was ist dagegen einzuwenden?
Man könnte über diese Fragen ja kontrovers diskutieren, wenn denn die Voraussetzung stimmen würde: Die Annahme, dass „Bild“ sich verändert hat. Ich wüsste nur gerne, wie Frau Thieme oder die Umweltverbände darauf kommen, dass „Bild“ vom Saulus zum Paulus geworden sei. Das ist ein lustiger logischer Kurzschluss: Wenn „Bild“ mit Greenpeace zusammenarbeiten will, muss sich „Bild“ so verändert haben, dass Greenpeace mit „Bild“ zusammenarbeiten will. Außer der Kooperation selbst und ihrem unbestreitbaren PR-Effekt für „Bild“ sehe ich kein Indiz für eine veränderte grundsätzliche Haltung von „Bild“ in dieser Frage.
Um die Paulushaftigkeit der Zeitung richtig einzuschätzen, lohnt es sich, das Buch ihres Chefredakteurs zu lesen — das Kapitel „Unser täglicher Weltuntergang“, in dem Kai Diekmann vor allem mit den Grünen abrechnet, aber auch mit dem angeblichen „Selbst-Betrug“ der Deutschen insgesamt:
Ein Katastrophenszenario jagt das nächste – die Religion des Ökologismus braucht neue Heilige. Waldsterben, Killerstürme, Feinstaub, CO2 – fast ist es ein Wunder, dass es uns noch gibt. In Wirklichkeit geht es meist um anderes. Man will dem Auto ans Leder, oder genauer: dem Autofahrer ans Portemonnaie. (…)
Vor allem bleibt in der Hysterie um den „Klimawandel“ der Einfluss Deutschlands auf die weltweite CO2-Produktion so gut wie außer Betracht. (…) Schon heute ist China gemeinsam mit den USA für mehr als ein Drittel der 30 Milliarden Tonnen Kohlendioxid verantwortlich, die jährlich in die Luft geblasen werden. (…)
Die Klima-Schlacht wird also nicht in Deutschland geschlagen oder in Europa. Sondern vor allem in Asien und Lateinamerika, also in der Zweiten und Dritten Welt. Und auch in den USA. Selbst bei optimistischen Berechnungen machen daher alle deutschen Anstrengungen zur Senkung der CO2-Emmissionen [sic!] allenfalls einen Rundungsfehler im Steigungswinkel aus. Auch hier sollten wir daher von der trügerischen Autosuggestion Abschied nehmen, dass an unserem Gewese die Welt genese: Selbst wenn ganz Deutschland nachts im Dunkeln auf die Toilette ginge, hätte das nicht den Hauch eines Einflusses auf den Klimawandel. (…)
Klimaschutz funktioniert nur als globale Lösung, wenn alle an einem Strang ziehen. Doch wir Deutschen stehen auf einsamem Posten, wenn es um die Reduzierung der CO2-Emissionen geht (…). Nicht zufällig ist Deutschland das einzige Land auf Erden, das seinen Ausstoß von Treibhausgas in den zurückliegenden Jahren reduzieren konnte (…).
Selbst wenn Deutschland sämtliche Produktion stilllegen, den Individualverkehr abschaffen und auf jegliches Heizen von Häusern und Wohnungen verzichten würde, hätte dies kaum einen positiven Einfluss. Dennoch tritt Bundesumweltminister Gabriel auf, als könnten seine Vorschläge die Welt retten.
Das soll keineswegs heißen, dass man nicht tun sollte, was möglich ist – aber möglich allein reicht nicht. Es muss auch sinnvoll sein, vor allem verhältnismäßig. (…)
Wie vieles andere in der deutschen Politik hat auch der Ausstieg aus der Atomenergie eine eindeutig irrationale Seite. Man steigt aus, weil der Begriff „Atom“ den Deutschen Angst macht – er erinnert an Atombombe, Atomschlag, Atomkrieg. Dabei wissen alle: Angesichts der Zahl der Reaktoren in unmittelbarer Nachbarschaft sinkt das Risiko nicht um einen [sic!] Jota. (…)
Ich wüsste gerne, wie Diekmann darauf kommt, dass Deutschland „das einzige Land auf Erden“ sei, das den Ausstoß von Treibhausgas reduziert hat. Diese Daten der UNO widersprechen seiner Behauptung jedenfalls (bei aller Ernüchterung) sehr deutlich. Und ich wüsste auch gerne, was Mathematiker zu Diekmanns Wahrscheinlichkeitsrechnung sagen, dass sich das Gesamtrisiko nicht vermindert, wenn man ein (egal wie kleines) Teilrisiko eliminiert. Das wär auch ein schönes Experiment: Man setzt den „Bild“-Chefredakteur in die Mitte von zwanzig kleinen Sprengkörpern, die alle mit einer gewissen, kleinen, aber unbekannten Wahrscheinlichkeit explodieren und ihn verletzen können. Er hat die Möglichkeit, zwei dieser Sprengkörper ganz auszuschalten. Verzichtet er darauf, weil er sagt, das macht doch eh „keinen Jota“ Unterschied?
Vor allem aber wüsste ich gerne, wie die organisierten Umweltschützer darauf kommen, dass die „Bild“-Zeitung bereit sei, von ihren Lesern Opfer und einen Beitrag zum schonenden Umgang mit Ressourcen zu verlangen, wenn ihr Chef davon überzeugt ist, dass ihr Tun und Lassen global gesehen eh egal ist.
Vom Rande der Gesellschaft ins Internet
 Oh wie toll: Die herrlich albernen „Am Rande der Gesellschaft“-Comics von Hauck & Bauer aus der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, die auf so wunderbare Weise gleichzeitig abseitig und wahr sind, haben jetzt auch online ein Zuhause.
Oh wie toll: Die herrlich albernen „Am Rande der Gesellschaft“-Comics von Hauck & Bauer aus der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, die auf so wunderbare Weise gleichzeitig abseitig und wahr sind, haben jetzt auch online ein Zuhause.
[via sapere aude in den Kommentaren]
Sammeln statt Lesen
Beim Tellerleeressen kann man zwei Schulen unterscheiden: Die einen stürzen sich sofort begeistert auf die leckersten Sachen und sitzen am Ende vor einem traurigen Gemüseberg. Die anderen achten sorgfältig darauf, sich das Beste für den Schluss aufzuheben, als würde der letzte Bissen über die dauerhafte Erinnerung an die Mahlzeit entscheiden, aber mit dem schönen Nebeneffekt, sich die ganze Zeit beim Essen darauf freuen zu können, dass das Beste noch kommt. (Okay, vermutlich gibt es daneben noch die mit Abstand anhängerreichste Schule derjenigen, die nie darauf kämen, darüber nachzudenken, in welcher Reihenfolge sie ihren Teller leeressen, jedenfalls nicht mehr, seit sie nicht mehr sieben sind.)
Ich gehöre, Sie ahnen es, zur zweiten Schule. Wenn Sie mich mal im „Schneeweiß“ mit einer Gans sehen, können Sie sicher sein, dass kein blöder Knödel als letztes vom Teller verschwinden wird.
Das ist, zugegeben, sehr egal. Ich habe mir nur in den letzten Jahren ein ähnliches Vorgehen beim Abarbeiten von Papierbergen angewöhnt. Und das ist nicht ganz so folgenlos.
Wenn andere Leute sich an einem Sonntagmittag schön zum Zeitunglesen hinsetzen, greifen sie sich die Teile, die sie am meisten interessieren, und lesen die Texte, die ihnen am spannendsten erscheinen. (So stelle ich mir das zumindest vor.) Ich dagegen fange an, erst mal die Teile durchzuarbeiten, bei denen ich davon ausgehe, dass so viel für mich nicht dabei ist. Das hat den Vorteil, dass ich nach 60 Sekunden schon, sagen wir, „Geld & Mehr“ zusammenfalten und als erledigt auf den Altpapierstapel legen kann, wodurch sich die vorwurfsvollen Blicke der ungelesenen Papierberge von letzter, vorletzer, vorvorletzter und der Woche davor besser ertragen lassen. Nach einer halben Stunde habe ich dann ungefähr keinen Artikel gelesen, aber das gute Gefühl, den ganzen für mich uninteressanten Kram schon aussortiert zu haben. Die besonders lesenswert erscheinenden Artikel, auf die ich bei dieser Art des Abarbeitens stoße, hebe ich auf. Die lese ich später dann mal schön in Ruhe. Mit Muße. In der Theorie.
Das ist ziemlich doof. Dieses Sortierverhalten führt nämlich dazu, dass ich die schönen Texte bestenfalls mit Tagen oder Wochen Verspätung lese, nämlich dann, wenn keine „Geld & Mehr“-Teile mehr wegzuarbeiten sind. Und schlimmstenfalls gar nicht, weil sie sich mit fortschreitender Zeit immer weniger nach Muss-ich-lesen und immer mehr nach Wird-so-interessant-schon-nicht-sein anfühlen.
Vielleicht das Dümmste daran ist, dass aus dem Papierberg regelmäßig soviel schlechtes Gewissen sickert, dass auch das Lesen der schönen Texte weniger mit Muße und mehr mit Pflichterfüllung zu tun hat. Es ist eher ein Wegarbeiten als ein Genießen und an die Stelle des guten Gefühls, einen schönen, klugen Text gelesen zu haben, tritt das gute Gefühl, bestimmte Papiermengen von Tisch ins Altpapier verschoben zu haben.
Ich weiß nicht, ob das beruflich bedingt ist oder nur eine besonders fehlgeleitete Form der Prokrastination ist. Die einfachste Gegenmaßnahme wäre sicherlich, konsequent alles Papier ungelesen wegzuwerfen, das älter ist als zehn Tage. Dann käme ich gar nicht erst in diese Aussortier-Stimmung — aber ungelesenes Wegwerfen von bedrucktem Papier bringe ich schon gar nicht übers Herz.
So ist das. Schon länger. Und es wird schlimmer: Seit kurzem bemerke ich, dass ich mit der unüberschaubaren Masse an Blog-Einträgen, die täglich in meinen Feedreader strömt, ganz ähnlich umgehe. Seit ich gemerkt habe, dass der Google-Reader, mit dem ich arbeite, diese praktische Sternchen-Funktion hat, mit der man Einträge markieren und später gezielt wieder aufrufen kann. Die Wirkung ist verheerend: Sobald sich ein paar hundert ungelesene Einträge angesammelt haben, lese ich die interessant erscheinenden nicht mehr sofort, sondern klicke nur auf die Schnelle durch: Uninteressant, uninteressant, aufheben, uninteressant, uninteressant, uninteressant, uninteressant, aufheben. Das führt dazu, dass ich den Informationsschwall scheinbar viel besser unter Kontrolle habe. Aber wieder um den Preis, die schönen Sachen zu sammeln, statt sie zu lesen.
Und je länger ich darüber nachdenke, umso weniger weiß ich, was die Essensgeschichte vom Anfang damit zu tun haben soll.
Kurz verlinkt (11)
(Sorry, schon bisschen mit Bart)
Ich bin mir nicht sicher, ob Springers Berliner Boulevardzeitung „B.Z.“ die dümmste Zeitung der Welt ist, halte das aber als Arbeitshypothese für ausreichend plausibel. Wie ihre Schwester „Bild“ macht die „B.Z.“ seit Monaten Stimmung für die Erhaltung des Flughafens Tempelhof. Als vorläufigen Höhepunkt hat sie Ende Oktober „100 gute Gründe für Tempelhof“ zusammengetragen. Die schönsten Stil- und Denkblüten hat Ghost Dog gepflegt auseinander genommen:
„Berlin braucht Tempelhof, weil die Bürgerinitiative zum Tempelhof-Erhalt und die CDU innerhalb weniger Monate ein Volksbegehren initiiert haben.
Die Logik ist bestechend. Weil eine Bürgerinitiative und die CDU für den Erhalt ist, braucht Berlin den Flughafen. Weil ohne den Flughafen könnte die Bürgerinitiative und die CDU ja nicht mehr für den Erhalt sein.
· · ·
„Messefernsehen für die Youtube-Generation“, nennt die sogenannte Fachzeitschrift „werben & verkaufen“ das, was sie bei den Münchner Medientagen produziert hat. Der Peer hat einige besonders schöne Stellen aufgeschrieben. Ich hätt‘ gerne was hinzugefügt, musste aber immer nach wenigen Minuten abbrechen, weil mein Bauch zu weh tat vor Lachen.
 (Dafür hat mich das halbe, schwarzweiße Gesicht von w&v-Chefredakteur Stefan Krüger bis in den Schlaf verfolgt. Wann war dieser Effekt nochmal in Mode? War da die YouTube-Generation schon geboren?)
(Dafür hat mich das halbe, schwarzweiße Gesicht von w&v-Chefredakteur Stefan Krüger bis in den Schlaf verfolgt. Wann war dieser Effekt nochmal in Mode? War da die YouTube-Generation schon geboren?)