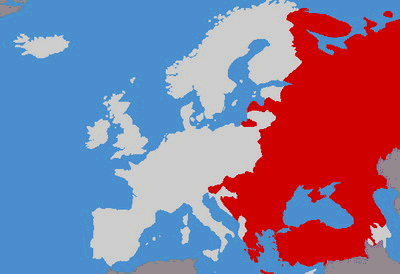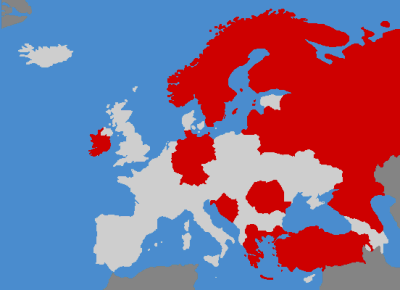Höchstens ein bißchen Frieden. Warum Bernd Meinunger, der Songschreiber von Corinna May, den Grand-Prix pervers findet und eigentlich nicht gewinnen möchte.
· · ·
TALLINN, 23. Mai. Es ist nicht so, daß alle hier verrückt wären nach dieser Veranstaltung. Bernd Meinunger hat sich auf die Suche nach einem Golfplatz in der Nähe gemacht und einen gefunden, keine dreißig Kilometer von Tallinn entfernt, den einzigen in Estland. Dort hat er mit seiner Frau Golf gespielt, wie er das jedes Jahr tut, wenn ein Lied seines Freundes und Kollegen Ralph Siegel Deutschland beim Song Contest vertritt und er wieder den Text geschrieben hat. Beim Empfang des Bürgermeisters ist Meinunger schnell verschwunden, da waren ihm zu viele Leute; das Gedränge in der Residenz des deutschen Botschafters am Tag darauf hielt er kaum eine Minute aus. Und während Siegel durch die Hallen tigert, aufgekratzter noch als früher, und in jedes Mikrofon diktiert, mit dem Herzen glaube er zu gewinnen, nur sein Verstand mahne ihn, sich nicht sicher zu sein, ist Meinunger eher genervt, sich überhaupt eine Stunde mit einem Journalisten hinsetzen zu sollen. „Der Grand-Prix ist pervers“, sagt er und krault sich den grauen Bart, „ich verstehe nicht, warum sich der Ralph da so reinsteigert und wo er diesen unglaublichen Enthusiasmus hernimmt. Sicher würde ich mich freuen, wenn wir gewinnen. Aber soviel Energie da reinstecken? Dafür ist mir das nicht wichtig genug.“
Dann sagt er noch, daß es irgendwie auch schade wäre, wenn Deutschland gewänne, schade für Nicole, die dann nicht mehr unsere Einzige wäre, wenn ausgerechnet Siegel zwanzig Jahre später den Erfolg wiederhole. Das ist ein Satz, der an Blasphemie grenzt, aber Meinunger darf so was sagen. Er und Siegel arbeiten seit einem Vierteljahrhundert zusammen, und ihre Beziehung lebt von dem Kontrast zweier Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Siegel, der Getriebene, der die totale Öffentlichkeit genießt und alles zu einem Kampf um Ehre, nationale und persönliche, verklärt. Meinunger, der Abgeklärte, der am liebsten im Hintergrund bleibt und schreibt, was andere bei ihm bestellen.
Seit 1978 sind die Texte des gelernten Agrarwissenschaftlers die Alltagslyrik und das Grundrauschen der Deutschen. Als er das letzte Mal nachzählte in seinem Computer, kam er auf 3800 Titel, die Platten hat er archiviert, „aber ich höre sie mir eigentlich nie an“. Die großen Siegelschen Grand-Prix-Nummern wie „Ein bißchen Frieden“, „Dschingis Khan“, „Theater“ stammen von ihm, die späten Platten von Rex Gildo und die frühen von Peter Maffay, er textet heute für Nicole und für Gaby Altenburg, leistet sich begeistert Ausflüge in deutschen Rap und erfüllt pflichtgemäß Anfragen aus der volkstümlichen Musik. Er sagt, daß er kaum einen seiner Texte auswendig könne und viele nicht einmal wiedererkennen würde.
Meinungers Texte sind schlicht und handeln von der Liebe. Und wenn man ihn fragt, ob das nicht ein bißchen wenig ist, schaut er treuherzig und fragt, ob es überhaupt ein anderes wichtiges Thema gebe, aber er sieht dabei aus, als wüßte er, daß das weder die Frage noch die Antwort ist. Morgens um neun setzt er sich in seinem Büro in München an den Computer, meistens bekommt er per E-Mail die Melodie, einen halben Tag später ist die neue Herzschmerz-Kombination fertig. Er sieht sich als Handwerker und lehnt auch den Ausdruck „Fließband-Arbeit“ nicht ab, aber er legt Wert darauf, das Optimale für den Zweck abzuliefern, nicht diesen „peinlichen Schrott“, der seit zehn Jahren die deutsche Schlagerlandschaft verhunze. Es sind Auftragsproduktionen, bei denen sich Meinunger selber ausdenken muß, worüber der Sänger wohl gerne singen würde, weil der oft nicht einmal das selbst formulieren kann. „Ich arbeite extrem künstlerorientiert; ich schreibe nicht, was ich denke und fühle“, beteuert er. Und er fragt sich, warum nicht viel mehr Menschen den Beruf ausüben, gerade 300 sind es in Deutschland bei fünfmal so vielen Komponisten, wo er doch der einfachste der Welt sei.
„Schlager haben nur eine Botschaft: Fühlt euch wohl!“, sagt er. Allergisch sei er gegen den Wunsch, daß Lieder „Themen anpacken“ sollen. Doch zu seinem Leidwesen sehnen sich offenbar auch die Künstler nach Bedeutungsschwere. „Nach Jahren, in denen sie erfolgreich über Liebe und sonst nichts gesungen haben, kommen sie plötzlich an und wollen was über Seehunde. Aber da sage ich: Nicht mit mir!“ Ein Umwelt-Lied namens „Verlorenes Paradies“, das er für Vicky Leandros geschrieben hat, hört er heute nur noch „mit Schaudern“. Aber beim Grand gelten ja eben andere Regeln. „Ein Grand-Prix-Lied braucht natürlich eine Botschaft“, sagt Meinunger, weil Siegel das sage. „Da bin ich von Ralph inzwischen gedrillt, da muß alles kalkuliert sein: Das Stück muß in Deutschland ankommen, um die Vorentscheidung zu überstehen, es muß überall in Europa gefallen, sogar in Österreich, es muß perfekt zum Künstler passen, und früher, als es noch Jurys gab, mußte immer noch ein bißchen Kunst drin sein. Absurd, oder?“ Der Siegertitel 1982 entstand, weil Siegel in dem Jahr unbedingt ein Friedenslied machen wollte, Meinunger aber auf gar keinen Fall ein Friedenslied schreiben wollte, und er irgendwann sagte: „Höchstens ein bißchen Frieden“. Damit war der Titel, die sogenannte „Zeile“, gefunden. Und Meinunger schwört, daß die Geschichte nicht nur schön, sondern auch wahr sei.
Die „Zeile“ sei das allerwichtigste, wichtiger oft noch als die Musik. Zu Meinungers unangenehmsten Aufgaben gehört, wenn Siegel anruft und sagt, er brauche jetzt schnell eine Handvoll Zeilen für Nicole, oder, schlimmer, ein Produzent mal eben fünfzig Zeilen für die Kastelruther Spatzen bestellt. Die meisten davon landen im Papierkorb, zu den wenigen anderen darf Meinunger später den restlichen Text dazuerfinden. Dessen Stellenwert sei aber nicht mehr hoch. Bei „I can’t live without music“ für Corinna May komme es eigentlich nur auf die Person der Sängerin, die Musik und die Titelzeile an. Der Rest ist kaum mehr als Füllmaterial.
„Zudringliche Weltbeschwörungsphantasien“ findet der Grand-Prix-Experte Jan Feddersen Jahr für Jahr in Meinungers Texten. Dahinter steckt ein Handwerk, das aus wenig mehr zu bestehen scheint, als die Begriffe „Traum“ und „Freiheit“ immer neu zu kombinieren. 1987: „Gib dem Traum ein bißchen Freiheit“. 1999: „Wir haben einen Traum, der nie die Kraft verliert. Leben ist eine Reise, die nach morgen führt“ (wohin sonst?). 1992, ungewöhnlich konkret und dadurch besonders perfide: „Siehst du dort das junge Mädchen, auf dem Bahnsteig stehn/Sie glaubt einer von den Zügen/wird in die Freiheit gehn/Und der Mann, der seinen Job verlor/träumt, daß er’s allen zeigt/Wie Phönix aus der Asche steigt.“ Das Werk trug den Titel „Träume sind für alle da“, der Meinungers ganzes Ruhigstellungs-Pathos und leeres Glücksversprechen wie kein anderer auf den Punkt bringt.
Nicht, daß er ein Reaktionärer wäre. Er engagierte sich politisch auf der Uni, war im linken SDS, fand nichts entsetzlicher als Chris-Roberts-Schlager. Siegel lernte er kennen, weil er ein Stück für sich selbst geschrieben hatte: „Song of emancipation“. Am Ende sangen ihn andere und brachten ihm 25 Pfennig Tantiemen ein, und Meinunger verabschiedete sich von den Idealen und begann mit dem Geldverdienen. „Was für Ideale soll man beim Schlagertexten haben? Das interessiert kein Schwein.“ Und Michael Kunze, auch ein erfolgreicher Texter, der Schlager wie das „Ehrenwerte Haus“ für Udo Jürgens und „Aufrecht gehn“ für Mary Roos geschrieben hat, die genau das Maß an Sozialkritik und Lebenswahrheit enthalten, die so ein kleines Lied enthalten kann – hat der es nicht geschafft, sich ein paar Ideale zu bewahren? Das sei die Ausnahme, sagt Meinunger. „Neunzig Prozent von dem, was Kunze schreibt, ist auch ganz braver Schlager.“
„Braver Schlager“ ist einer der freundlicheren Ausdrücke für die Musik, die er hauptsächlich produzieren hilft. Das Adjektiv „beschissen“ benutzt er für einen Achtundfünfzigjährigen mit der Ausstrahlung eines ruhigen bayerischen Brummbärens erstaunlich oft, auch für den Disco-Trash der Gruppe „E-Rotic“, der er mit viel Spaß Texte wie „Max don’t have sex with your ex“ bescherte. Peter Maffay warf ihm einmal vor, daß er neben seiner Arbeit für ihn für so viele andere entsetzliche Leute arbeite. Meinunger erwiderte, er sei Architekt: „Ich kann nicht jeden Tag Villen zaubern, ich muß auch viele Garagen bauen.“ Vielleicht fünf Prozent dessen, was er so getextet habe, sei „ganz schön“, zu dem Rest sagt er: „Es wäre genauso gut gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte“ — auch in finanzieller Hinsicht, weil sich das meiste dann doch nicht verkauft. Andererseits kann er sich nicht vorstellen, daß ihm je die Lust vergeht, auch noch den fünftausendsten Schlager-Text aufzuschreiben.
Er hat Chris Roberts dann irgendwann kennengelernt und gemerkt, daß das ein ganz belesener, kluger Mann ist. Und er hat sich in einem ähnlichen Maß von der Branche korrumpieren lassen, wie er es bei ihm und anderen feststellte. Nur die Leidenschaft, die läßt er sich nicht absprechen. „Ich habe nicht weniger Leidenschaft als Ralph Siegel, aber ich bin realistischer. Ich lebe nicht mehr in der Zeit vor zwanzig Jahren, als der Grand Prix wichtig war und Platten verkaufte und Karrieren begann.“ Aber ins Schwärmen kommt er nur bei den alten Geschichten, wenn er über die anstrengende Zusammenarbeit mit Maffay redet und darüber, wieviel Spaß es machte, für Dschingis Khan zu schreiben, die nie eine Botschaft hatten. Und dann schwärmt er noch für Reinhard May, der Alltagsgeschichten so grandios erzähle, wie er es nicht könne. Und wie er schon in dessen allererste Platte „reingekrochen“ ist.
In welches Lied von Bernd Meinunger möchte man reinkriechen?
(c) Frankfurter Allgemeine Zeitung
 78 Mitspieler haben bei meiner kleinen Grand-Prix-Wette mitgespielt, und nach einem gefühlt mehrtägigen Kampf mit einer Excel-Tabelle kann ich nun die stolzen Gewinner bekanntgeben. Den ersten Platz teilen sich mit jeweils fünf Punkten:
78 Mitspieler haben bei meiner kleinen Grand-Prix-Wette mitgespielt, und nach einem gefühlt mehrtägigen Kampf mit einer Excel-Tabelle kann ich nun die stolzen Gewinner bekanntgeben. Den ersten Platz teilen sich mit jeweils fünf Punkten: