Zurückrudern ist noch nicht olympisch, aber Christoph Keese übt schon mal in der Disziplin Einer ohne Steuermann. Der Außenminister der Axel-Springer-AG behauptet in seinem privat betriebenen Dienst-Blog jetzt nicht mehr, dass das geplante Presse-Leistungsschutzrecht unproblematisch sei, sondern nur noch, dass es nicht unbedingt problematisch sein müsse, wenn die Rechteinhaber verantwortungsvoll damit umgingen.
Am vergangenen Freitag hatte er noch geschrieben: „In Wahrheit müssen Blogger das Leistungsschutzrecht nicht fürchten (…).“ Heute schreibt er unter der Überschrift: „Keine Abmahnwellen, faire Preise! Wie das Leistungsschutzrecht genutzt werden sollte“ — was implizit wohl bedeutet, dass solche Abmahnwellen theoretisch sehr wohl denkbar wären.
Keeses neuer Text ist ein Appell:
Das Leistungsscutzrecht (sic) für Presseverlage sollte von Verlagen und Bloggern verantwortungsvoll genutzt werden. Dazu gehört, dass die Rechte schnell und unkompliziert geklärt werden können, dass harmlose Nutzer weder kriminalisiert noch mit Abmahnwellen überzogen werden und dass es attraktive Preise gibt. (…)
Harmlose Blogger, die hin und wieder Texte von Verlagen übernehmen, dabei manchmal die Grenzen des Zitierens überschreiten und nebenbei ein bisschen Werbung auf ihren Seiten verkaufen – diese Kreativen sollten völlig angstfrei mit den Leistungen der Verlage umgehen können. (…)
Wer keine Lust hat, eine Flatrate abzuschließen, aber trotzdem weiter kopiert, wird nicht mit Abmahnwellen überzogen, sondern bekommt ab und zu neue Vertragsangebote. Er ist ein potentieller Kunde und sollte nett behandelt werden. Überhaupt sollte das Leistungsschutzrecht nicht mit Abmahnwellen durchgesetzt werden. (…)
Tweets und Links, auch Linksammlungen, beleben das Netz. Man sollte nicht den Leuten nachsteigen, die dieses Leben ins Netz bringen.
Man sollte nicht, sagt Keese, aber er bestreitet nicht, dass man es mithilfe des neuen Leistungsschutzrechtes könnte.
Der Text ist nicht nur ein unterschwelliges Eingeständnis, wie weitreichend und potentiell zerstörerisch die Folgen einer Monopolisierung der Sprache ist, wie sie der Entwurf vorsieht, der auch kleinste Teile eines Presseerzeugnisses schützt. Er erfordert von den Lesern und Betroffenen auch, den Verlagen Maß, guten Willen und Verlässlichkeit zuzutrauen.
Dazu besteht kein Anlass.
Nicht nur wegen Fällen wie dem des Regisseurs Rudolf Thome, dem der „Tagesspiegel“ nachstieg, weil er ohne Genehmigung zwei alte Kritiken über Filme von ihm auf seine Website gestellt hatte. Fast tausend Euro kostete ihn die Abmahnung der Zeitung, für die er früher selbst geschrieben hat.
Sondern zum Beispiel auch wegen der Sache mit den Gemeinsamen Vergütungsregeln. Laut Urheberrecht hat ein Urheber einen Anspruch auf „angemessene Vergütung“. Um die zu bestimmen, gibt es im Gesetz seit 2002 das Mittel der „gemeinsamen Vergütungsregeln“, auf die sich etwa Journalisten- und Verlegerverbände einigen müssen.
Acht Jahre haben danach die Verhandlungen gedauert, bis beide Seiten sich endlich auf einen zweifelhaften Kompromiss mit Mindesthonoraren für Freie Zeitungs-Journalisten geeinigt haben. 2010 traten sie in Kraft. Doch laut dem Verband Freischreiber (bei dem ich Mitglied bin) hält sich die Mehrzahl der Verleger einfach nicht daran.
Freie Journalisten, die auf die Einhaltung der Regeln pochen, bekommen nicht selten keine neuen Aufträge mehr. Der Gang vor Gericht ist für den Einzelnen nur machbar, wenn er dem Auftraggeber ohnehin den Rücken kehren will — eine Verbandsklage zur Durchsetzung der Regeln ist nicht vorgesehen.
Ein Verlegerverband wies seine Mitglieder 2010 darauf hin, dass die Gemeinsamen Vergütungsregeln „nicht zwingend von den Verlagen angewendet werden [müssen]. Die Vergütungsregeln nicht anzuwenden, kann nicht sanktioniert werden.“ Und weiter:
Die Gemeinsamen Vergütungsregeln besitzen nicht die „Qualität“ eines Tarifvertrages. Zeitungsverlage können ihre hauptberuflich freien Journalisten nach der Honorartabelle bezahlen und gelangen dann in den „Genuss“, dass diese Vergütung für journalistische Tätigkeit als angemessen im Sinne des Urheberrechtsgesetzes gilt.
So kann man das also formulieren: Viele Zeitungsverlage verzichten auf die Möglichkeit, in den Genuss zu kommen, ihre freien Journalisten angemessen zu bezahlen.
Auch die Nutzungsverträge und Geschäftsbedingungen, die die Verlage den Urhebern diktieren, verstoßen vielfach gegen geltendes Recht.
Der „Journalist“, das Verbandsorgan des DJV, berichtete im vergangenen November:
Rund ein Dutzend Verfahren führen der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) und die Deutsche Journalisten-Union (dju) in ver.di unter Führung des DJV derzeit. Die Verlage kassieren dabei eine Niederlage nach der anderen, geben aber oftmals nicht auf, sondern ziehen vor die nächsthöhere Instanz. Würde Realität, was Verleger durchsetzen wollen, wäre das das Ende des Urheberrechts, wie wir es hierzulande kennen.
Die Schuldigen sind die vermeintlich renommiertesten Verlage der Republik. Sie kassieren für ihr Vorgehen Urteile, in denen Sätze stehen wie: „Dass von zwingendem Recht nicht abgewichen werden darf, bedarf eigentlich keiner Erwähnung.“ Es wirkt wie ein fast flächendeckender, systematischer Versuch des Rechtsbruchs.
Ironischerweise sagen Verlage wie Springer, sie müssten die Urheber (rechtswidrig) enteignen, weil es ja kein Leistungsschutzrecht gibt. Auch Christoph Keese nennt als Argument für das Leistungsschutzrecht für Verlage, dass man dann den Urhebern nicht mehr so viele Rechte wegnehmen müsste — eine Argumentation, die auf die Logik hinausläuft: Gebt uns ein neues Recht, damit wir das Recht nicht mehr brechen müssen.
Im Entwurf für das neue Leistungsschutzrecht steht übrigens der Satz: „Der Urheber ist an einer Vergütung angemessen zu beteiligen.“ Was das Wort „angemessen“ für Verleger bedeutet, wissen viele freie Journalisten.
Und damit zurück zu Christoph Keese und seinem doppelten Appell: An seine Kollegen in den Verlagen, maßvoll zu sein, und an die Betroffenen, von einem maßvollen Vorgehen der Verlage auszugehen.
Wenn das Leistungsschutzrecht nur ungefährlich ist, solange die deutschen Verlage sich gutwillig, vernünftig, zurückhaltend und maßvoll verhalten, muss man dieses Gesetz fürchten.

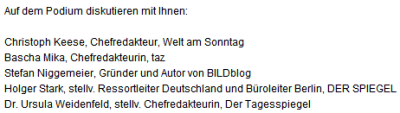
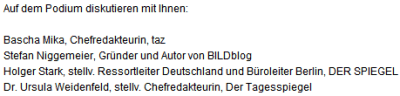
 Ich habe leider keinen Zugriff auf das interne Springer-Archiv, aber im Online-Archiv der „Welt“ lässt sich der Artikel auch nicht finden. Und wer immer ihn gelöscht hat — er hat ganze Arbeit geleistet: Im
Ich habe leider keinen Zugriff auf das interne Springer-Archiv, aber im Online-Archiv der „Welt“ lässt sich der Artikel auch nicht finden. Und wer immer ihn gelöscht hat — er hat ganze Arbeit geleistet: Im