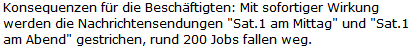Man kann es nicht deutlich genug sagen: Es geht bei Sat.1 nicht darum, dass da gerade kluge, informative, relevante, irgendwie nachrichtliche Sendungen abgewickelt würden. Wer die Formate „Sat.1 am Mittag“ oder „Sat.1 am Abend“ als „Nachrichten“ oder „wichtige Informationssendungen“ bezeichnet, wie u.a. die „Süddeutsche Zeitung“, Spiegel Online und die Agentur ddp, beweist damit, dass er die Programme nie gesehen hat. Es handelt sich um Sendungen, in denen Strapse, Push-Up-BHs und „sexy Badeanzüge“ getestet, teils Jahre alte Doku-Soaps in Häppchen zerlegt wiederverwertet und idiotische Gewinnspiele veranstaltet wurden.
Das Problem ist nicht, dass den neuen Besitzern von Sat.1 die Produktion von Nachrichtenmagazinen zu teuer geworden ist. Das Problem ist, dass den neuen Besitzern von Sat.1 selbst die Produktion dieser billigsten Magazinattrappen zu teuer geworden ist.
Man könnte das für eine gute Nachricht halten, ein Ende der Heuchelei: Informationssendungen in nennenswertem Umfang haben die Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe schon lange nicht mehr im Programm, warum soll man den Schein-Informationssendungen, die sie stattdessen ausgestrahlt haben, nachtrauern?
Darum: Weil sie ein Zeichen dafür waren, dass den Sendern noch nicht alles, was nicht „Rendite“ hieß, ganz egal war. Die Sendungen hatten ja nicht zufällig Namen und Verpackungen, die sie seriöser wirken ließen, als sie waren: Ihre Existenz verdanken sie unter anderem der Annahme, dass es sich für einen großen Sender, auch für einen Privatsender, auszahlt, wenn er ein gutes Image hat. Wenn er als irgendwie relevant wahrgenommen wird und nicht nur als beliebige Abspielstation mit den schönsten Serien der 80er und 90er und dem Besten von heute.
Die Absetzung der Magazine zeigt, dass die Finanzinvestoren, denen ProSiebenSat.1 jetzt gehört, auf solche Strategien, die langfristig zum Erfolg eines Senders beitragen, pfeifen. Wenn es aber ausschließlich darum geht, in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Einsatz eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften, dann geht es um die Existenz von viel mehr als ein paar Boulevardmagazinen. Dann lohnt es sich auch nicht mehr, in die Entwicklung eigener Serien zu investieren oder hochwertige Fernsehfilme zu produzieren. Dann wird es nie wieder gewagte Experimente geben und Prestigeprogramme, keinen langen Atem und keinen Glauben an die eigene Kreativität, kein Durchhalten, weil man von der Qualität oder gar Relevanz eines Programms überzeugt ist. Dann wird es, in einem noch viel stärkeren Maße als bisher, ausschließlich billige Dokusoaps, billige Gerichtsshows, billige Pseudo-Dokumentationen, eingekaufte Serien und tausendfache Wiederholungen, Kopien und Imitate geben.
Natürlich wird ein Sender wie Sat.1 dadurch Zuschauer verlieren. Das wird den neuen Besitzern aber noch egaler sein, als es den alten schon war. Ziel der Privatsender ist es ja nicht, so viele Zuschauer wie möglich zu erreichen. Ihr Ziel ist es, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Und beides hängt nicht zwingend zusammen. Das Beispiel „Sat.1 am Mittag“ zeigt es: Es ist unmöglich, die Absetzung der Sendung mit ihrem mangelndem Erfolg zu begründen. Nach einer schwierigen Anfangsphase hat die Sendung in den vergangenen Wochen hervorragende Quoten erzielt. Die letzte Sendung gestern hatte in der Zielgruppe einen Marktanteil von 18 Prozent – Sat.1 kommt in diesem Monat bisher auf im Schnitt 10,9 Prozent. Auch „Sat.1 am Abend“ lag gestern über diesem Wert. Aber natürlich lassen sich Sendungen produzieren, die etwas weniger Zuschauer haben, aber viel weniger kosten – und ein besseres Verhältnis von Aufwand zu Ertrag haben, rein finanziell gerechnet.
Es ist natürlich eine Lüge, wenn sich ProSiebenSat.1-Chef Guillaume de Posch hinstellt und behauptet, die Entlassungen und Absetzungen hätten etwas damit zu tun, dass gerade die Quoten von Sat.1 so schlecht sind. Es ist genauso eine Lüge wie all die Beteuerungen der vergangenen Monate, es werde nicht zu Sparmaßnahmen im Programm und nicht zu größeren Entlassungswellen kommen. Aber auch das ist Teil der neuen, verschärften Privatfernsehlogik: Wer nur auf den kurzfristigen Ertrag setzt, kann es sich auch leisten, in der Öffentlichkeit als Lügner dazustehen. Er kann es sich auch leisten, treue Serienfans ununterbrochen zu verprellen, wie es ProSieben seit einiger Zeit mit großer Konsequenz tut, offenbar immer mit dem Kalkül, dass es wichtiger ist, kurzfristig die Zahlen zu bessern als sich langfristig eine treue Fangemeinde aufzubauen.
Bei Sat.1 zeigt sich gerade in besonders krasser Form, was Günther Jauch mir in einem Interview vor zweieinhalb Jahren gesagt hat:
Es gibt eine Entwicklung, der zumindest ARD, ZDF, RTL, Sat.1 und Pro Sieben nicht folgen sollten. Es funktioniert so: „Wir holen eine alte Krimiserie aus dem Keller oder produzieren zu absoluten Billigpreisen irgendein neues Schrottprogramm nach amerikanischem Vorbild. Selbst wenn wir damit nur eine schwache Quote schaffen, bleibt letztlich mehr in der Kasse, als wenn wir ein Qualitätsprogramm mit Quote produzieren.“ Dann wäre die Quote sogar im kommerziellen Fernsehen nicht mehr so wichtig. An ihre Stelle tritt die Rendite – oder bei den Öffentlich-Rechtlichen die möglichst billige Produktion. Wenn keiner mehr den Ehrgeiz hat, Qualität zu machen, oder Quote – oder Qualität mit Quote zu verbinden, was durchaus geht -, dann krieg‘ ich als Journalist und Moderator, aber auch als Produzent ein Problem. Denn dann wird das Fernsehen richtig freudlos. Bisher war alles ganz einfach: „Mach ’ne schöne Quote“, das war das wichtigste, „und ’ne schöne Sendung haste auch noch gemacht, prima.“ Danach wurde man bewertet. Da droht gerade ein Paradigmenwechsel, der für Leute, die auf Quote und Qualität setzen, zum Problem werden kann.
Man sollte sich nicht davon täuschen lassen, dass diesem Paradigmenwechsel gerade Sendungen wie „Sat.1 am Mittag“ zum Opfer fallen, denen man, wenn man mit ihnen nicht seinen Lebensunterhalt verdient, wirklich keine Träne nachweinen mag. Die Freudlosigkeit des Fernsehens hat gerade erst richtig begonnen.
Lesetipps (teils Eigenwerbung):
— medienpiraten.tv über Sat.1 am Mittag
— Der Popkulturjunkie über die skandalösen Falschmeldungen der Gewerkschaften und die Mär, dass Sat.1 ein Lizenzentzug droht
— „Das Fernsehlexikon“ über Hilferufe aus dem Sat.1-Text und das Programmrecycling bei Sat.1
— DWDL.de über die offizielle Begründung der Absetzungen und Kündigungen
Beste Informationsquelle über die Vorgänge bei ProSiebenSat.1 ist übrigens ohne Zweifel das Online-Medienmagazin DWDL.de. Die entsprechende Eigenlobhudelei von DWDL-Chef Thomas Lückerath im Redaktionsblog liest sich zwar, freundlich formuliert: ein bisschen merkwürdig. Aber im Kern hat er Recht.
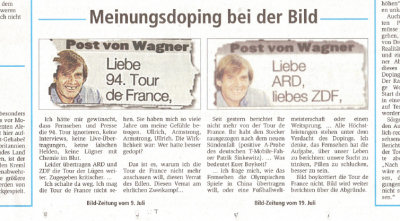

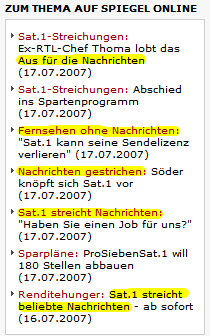 was kann ich tun, damit Ihr aufhört, die gerade eingestellten Mischmagazine „Sat.1 am Mittag“ und „Sat.1 am Abend“ als „Nachrichten“ zu bezeichnen?
was kann ich tun, damit Ihr aufhört, die gerade eingestellten Mischmagazine „Sat.1 am Mittag“ und „Sat.1 am Abend“ als „Nachrichten“ zu bezeichnen?