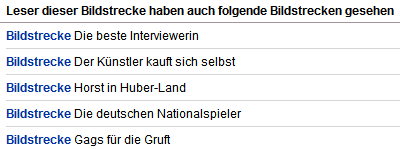Schwerer Selbstreferenz-Überschuss im Moment in diesem Blog, aber was soll’s.
Stefan Winter hat auf jetzt.de einen Text darüber geschrieben, wie ihn BILDblog nervt. Und wie ich ihn nerve. Er beginnt so:
Es passiert selten, dass Stefan Niggemeier das in Frage stellt, was er den ganzen Tag so tut. Der Mann, der für Bildblog und sein Privatblog bereits zwei Grimme-Online-Awards bekommen hat, inszeniert sich lieber so, als habe er allein den doofen Deutschen den Segen des Internets gebracht. Heute jedoch scheint Internet-Gott Niggemeier eine menschliche Regung in sich gespürt zu haben.
Okay, das ist nicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Es passiert oft, dass ich das in Frage stelle, was ich den ganzen Tag so tue. Eigentlich ununterbrochen. Manchmal frage ich mich sogar, ob ich mir nicht zuviele Fragen stelle, aber das fügt den Zweifeln nur noch Metazweifel hinzu. Und Kopfschmerzen.
Jetzt sitze ich hier und frage mich zusätzlich noch, womit ich bei Leuten den Eindruck erweckt haben könnte, ich hielte mich für einen „Internet-Gott“ (und ich hatte gedacht, das absurde Etikett „Blog-Papst“, das mir mal jemand anbappen wollte, ließe sich nicht mehr toppen). Na bravo. Andererseits: Als Journalist, vor allem als Fernsehkritiker, urteile ich dauernd über Leute, die ich nicht kenne, und packe sie in Schubladen, in denen sie vermutlich gelegentlich ähnlich entgeistert sitzen wie ich jetzt in dieser.
Im Kern scheint Stefan Winter mir und BILDblog zwei Dinge vorzuwerfen. Das eine ist, unmoralisch zu sein.
Wenn Stefan Niggemeier das Bildblog als seine Arbeit bezeichnet und davon leben will, heißt das: Er lebt (zumindest indirekt) von dem Dreck, den die Bildzeitung täglich verbreitet. Für jemanden mit seinem moralischen Standard, finde ich das zumindest fragwürdig.
Das finde ich eine erstaunliche These. Sie bedeutet, dass es legitim ist, davon zu leben, die Leute zu desinformieren. Aber nicht, davon zu leben, die Leute über diese Desinformation aufzuklären. Das ist eine ähnliche Argumentation wie die der „Bild“-Zeitung, die meint, BILDblog dürfte sich beim Presserat nicht über „Bild“ beschweren, weil wir die Institution dadurch für unsere kommerziellen Zwecke missbrauchten.
Trifft das Urteil der moralischen Fragwürdigkeit jeden, der zum Beispiel Journalist geworden ist, um Missstände aufzudecken? Müssen sich Journalisten wie Thomas Kistner oder Jens Weinreich, die sich darauf spezialisiert haben, Korruption und Doping im Sport aufzudecken, auch vorwerfen lassen, dass sie (zumindest indirekt) von dem Fehlverhalten anderer leben? Ist Hans Leyendecker letztlich auch nur ein Schmarotzer, der das Aufdecken von Skandalen als lukrative Marktlücke entdeckt hat und einpacken kann, sobald sich alle anständig verhalten? (Nicht ganz unberechtigt ist auch die Frage von Kommentatoren auf jetzt.de, wie unmoralisch eigentlich Müllmänner sind, die sich ja letztlich auch nur ihr kommerzielles Süppchen aus unserem Dreck kochen.)
Das zweite, das Stefan Winter an uns nervt, sind eigentlich nicht wir und unsere Arbeit, sondern deren Rezeption. Wir würden von Blogosphäre und klassischen Medien „in (ungewohnter) Eintracht hofiert“, schreibt er und beklagt sich über „Kamerateams“, die in unser Büro „einfielen“, um „(meist völlig unkritisch)“ über unsere Arbeit zu berichten.
Ich glaube, das täuscht. Abgesehen vom NDR-Medienmagazin „Zapp“, das mehrmals und freundlich über uns berichtete, wird es Winter schwerfallen, Spuren von eingefallenen Horden von Fernsehleuten in unserem Büro zu finden. Ja, wir sind so etwas wie ein „Vorzeigeblog“, auf das klassische Medien kommen, wenn sie über Blogs überhaupt berichten, was zum einen an ihrer Einfallslosigkeit liegt, zum anderen an unseren Leserzahlen. Aber wer „hofiert“ uns wirklich? Die „Süddeutsche Zeitung“ sicher nicht, die vergangene Woche Donnerstag erstmals einen eigenen kleinen Artikel über uns geschrieben hat. Hofiert wird von den Medien Tag für Tag die „Bild“-Zeitung, durch Aufmerksamkeit, ungeprüfte Übernahme ihrer Meldungen, Ausblenden von Kritik. Bei der Nachrichtenagentur dpa zum Beispiel sind kritische Berichte über „Bild“ — und damit jeder Bericht über uns — Tabu heikel. Eine PR-Geschichte für Katja Kesslers neues Buch ist erlaubt.
Aber es stimmt schon: Wir haben viele Fans und Freunde. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, das negativ zu sehen, weil es ein so sensationelles, ungekanntes Gefühl ist: das Wohlwollen, die Unterstützung, die Bereitschaft mitzuhelfen. Und wenn Stefan Winter behauptet, „alle“ würden uns „unreflektiert“ gut finden, möchte ich ihm doppelt widersprechen. Erstens hoffe ich, dass es Leute gibt, die uns reflektiert gut finden. Und zweitens stimmt es einfach nicht. Ein einziges Blog hat Winter gefunden, das am BILDblog-Werbespot Kritik übt (und Winter gibt ihm in seiner Verzweiflung recht, obwohl es den Film vor allem deshalb ablehnt, weil die Produktionsfirma Brainpool „eigentlich alle schlechten Formate auf privaten Sendern“ zu verantworten habe).
Herr Winter, schau’n Sie mal: hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier oder hier.
Ein letzter Gedanke noch. Stefan Winter schreibt: „Bildblog arbeitet nicht ehrenamtlich oder für den guten Zweck, sondern aus einem kommerziellen Interesse.“ Ich streite mich gerne über die Macken und Fehlentwicklungen, das Gefährliche, Blöde und Falsche an BILDblog (und stelle mich und meine Arbeit dabei auch gern in Frage). Aber ich lasse mir ungern den Glauben nehmen, dass „für den guten Zweck“ und „aus einem kommerziellen Interesse“ sich nicht ausschließen müssen. Wär doch furchtbar, wenn man seinen Lebensunterhalt nur mit Dingen verdienen könnte, die eigentlich Scheiße sind.
Und ich sage das nicht als Internet-Gott.




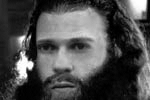
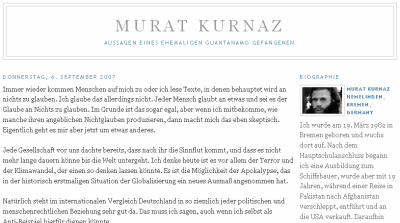

 (A) Anke Engelke, Michel Friedman, Peter Scholl-Latour, Dt. Fernsehpreis
(A) Anke Engelke, Michel Friedman, Peter Scholl-Latour, Dt. Fernsehpreis (B) Georg Kofler
(B) Georg Kofler (C) Goldenem Panther, Bayerischer Fernsehpreis
(C) Goldenem Panther, Bayerischer Fernsehpreis (D) Stefan Aust
(D) Stefan Aust (E) Dirk Bach, Moderation Dt. Fernsehpreis
(E) Dirk Bach, Moderation Dt. Fernsehpreis