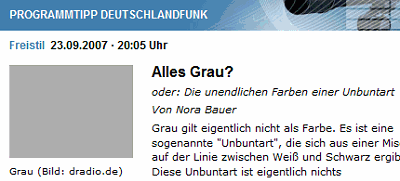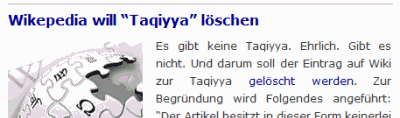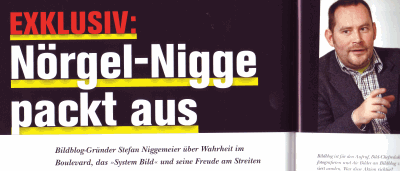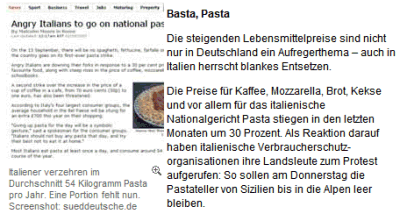Vor einiger Zeit bin ich von zwei Schülern der Deutschen Journalistenschule in München (auf der ich auch war) für ihre Abschlusszeitschrift interviewt worden. Und weil ich das Ergebnis so gelungen finde und fürchte, dass kaum jemand das schöne Magazin zum Thema Fehler in die Finger bekommt, veröffentliche ich den Text einfach selbst — mit freundlicher Genehmigung der Autoren.
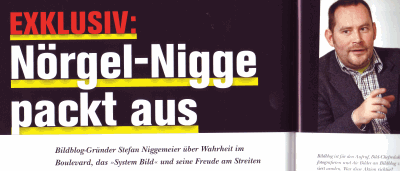
Bildblog-Gründer Stefan Niggemeier über Wahrheit im Boulevard, das „System Bild“ und seine Freude am Streiten
Interview: Till Haase, Adrian Renner
Foto: Ulf Hanke
Herr Niggemeier, auf Bildblog.de decken Sie seit zweieinhalb Jahren die Fehler der Bild-Zeitung auf, mit 40.000 Lesern täglich sind Sie Deutschlands meistgelesener Blog. Warum hat Ihnen die Bild-Zeitung noch nicht Ihr Bild-Abonnement gekündigt?
Das wäre wohl eine etwas kurzsichtige Strategie. Aber wir hatten die lustige Situation, dass wir bei Bild angefragt haben, ob wir ihr Archiv nicht als kommerzieller Kunde nutzen können. Es hat dann sehr lange gedauert bis wir eine Antwort erhalten haben. Das Ergebnis war: nein, auch gegen Geld nicht.
Der letzte Bildblog-Eintrag ist inzwischen drei Tage alt. Ist das gut oder schlecht für Bildblog?
Schlecht, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube, dass Bild in den letzten drei Tagen Fehler gemacht hat, auch gravierende. Wir haben sie nur nicht entdeckt.
Wie entdecken Sie denn Fehler in Bild? Haben Sie eine Fehlersuchstrategie?
Gut die Hälfte der Fehler entdecken wir durch Hinweise unserer Leser. Und dann lohnt es sich immer, bestimmten Signalwörtern nachzugehen. Bei „Geheimplan“ zum Beispiel schauen wir, ob das nicht schon vor einem Monat veröffentlicht wurde, oder bei „sagte zu Bild„, ob das nicht in einer Nachrichtenagentur stand. Und natürlich immer, wenn Bild über Außerirdische schreibt.
Was ist das dann für ein Gefühl, wenn man einen Fehler gefunden hat? Freude?
Nee. Meistens ist das ein Entsetzen. Ich bin immer wieder fassungslos, wenn man anfängt, eine Geschichte nachzurecherchieren, und sieht, was Bild daraus gemacht habt. Amüsieren kann ich mich bei diesen blöden Fehlern, wenn man sich sagt: Mein Gott, die haben das wieder nicht kapiert. Da kommt eine gewisse Schadenfreude auf.
Einen Fehler muss man auch beweisen. Auf welche Quellen verlassen Sie sich denn?
Es hilft, Originaldokumente zu finden, wissenschaftliche Studien zum Beispiel. Es hilft, wenn Nachrichtenagenturen oder andere Zeitungen über ein Thema geschrieben haben, wobei wir da auch vorsichtig sind. Ganz heikel ist es, wenn Aussage gegen Aussage steht. Wir wollen aus Bildblog kein Gegendarstellungsportal machen, nach dem Motto: Bild schreibt etwas und wir geben jedem eine Stimme, der sagt, das habe ich so aber gar nicht gemeint.
Gehen Sie bis zum Beweis der Tat, bis sie augenfällig ist, von einer Unschuldsvermutung aus?
Im Idealfall ja. Aber es ist die Unschuldsvermutung gegenüber einem Serientäter. Wenn einer schon 100 alte Frauen ausgeraubt hat, muss man ihm die 101. neu beweisen. Aber es gibt gute Gründe, ihn für verdächtig zu halten.
Seit Januar dieses Jahres finanziert sich Bildblog neben Spenden und dem Verkauf von Bildblog-Produkten auch über Werbung auf der Seite. Ist der Druck, Fehler zu finden, seitdem gestiegen?
Wir ertappen uns manchmal bei dem Gedanken, denn natürlich haben wir mehr Leser auf der Seite, je mehr wir schreiben, versuchen dem aber nicht nachzugeben. Der eigentliche Druck ist ein anderer. Wir bekommen täglich Dutzende Hinweise von unseren Lesern, und wir versuchen allen nachzugehen und alle nachzurecherchieren. Dieser Druck ist viel stärker als der Werbedruck.
Bildblog ist für den Aufruf, Bild-Chefredakteur Kai Diekmann zu fotografieren und die Bilder an Bildblog zu schicken, stark kritisiert worden. War diese Aktion richtig?
Zunächst war die Aktion im Nachhinein eher enttäuschend, weil wir so wenig Bilder erhalten haben. Was ich bei der Kritik nicht verstanden habe, ist, dass uns vorgeworfen wurde, wir würden uns auf Bild-Niveau begeben. Ich finde es grundsätzlich nicht verwerflich, Leser aufzufordern, Bild spannende Fotos zu schicken. Verwerflich ist, dass bei der Veröffentlichung dieser Fotos das Persönlichkeitsrecht offensichtlich keine Rolle spielt.
Warum macht denn Bild so viele Fehler? Weil sie es will oder weil sie es nicht besser kann?
Beides. Bild macht absichtlich Fehler, Dinge werden falsch dargestellt, weil es dann eine „bessere“ Geschichte wird. Und Fehler entstehen, weil Bild schlampig arbeitet. Wenn man beides zusammenfasst, könnte man sagen, dass vielleicht die Wahrheit bei Bild nicht das Entscheidende ist.
Sondern die Verwertbarkeit?
Ja. Ich glaube, jeder Bild-Mitarbeiter arbeitet unter einem immensen Druck, die bestmögliche Geschichte abzuliefern, und das ist nicht immer die, die am Ende noch zutrifft. Dahinter muss im Einzelfall nicht einmal immer eine böse Absicht stecken. Anders ist es bei Themen, wo Bild eine Agenda hat, bei der Rente zum Beispiel. Für Bild lohnt es sich einfach, jeden Tag aufzuschreiben, dass die Renten nicht sicher sind, selbst wenn sie dafür Argumente erfinden oder Tatsachen verdrehen muss.
Kann es denn eine Bild-Zeitung ohne Fehler überhaupt geben?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wallraff hat vor 30 Jahren in seinen Büchern Mechanismen beschrieben, bei denen ich das Gefühl habe, die gelten heute immer noch. Dieses Stille-Post-Spiel zum Beispiel, dass am Ende jemand die Überschriften über den Text macht, der die Ursprungsfassung gar nicht kennt.
Wenn sich über so lange Zeit nichts ändert, ist es dann das System Bild, dass die Fehler hervorruft?
Es ist das Prinzip, auf jeden Mitarbeiter den Druck aufzubauen, die Geschichte zu liefern, die zur größten Schlagzeile taugt. Das führt im besten Fall dazu, dass Bild Sachen herausfindet, die andere nicht herausfinden. Aber oft genug führt es dazu, dass Leute aufschreiben, was sie oder ihre Vorgesetzten für die gute Geschichte halten. Ich weiß nicht, ob Bild ohne dieses Prinzip funktionieren kann, ob man Bild revolutionieren oder reformieren kann.
Sehen Sie sich denn selbst als Chronisten oder als Entertainer?
In diesem Gegensatz zu 100% Chronist, wobei: Chronist klingt mir fast zu unbeteiligt. Was wir machen, hat auch etwas Kämpferisches. Aber mir ist klar, dass uns Leute lesen, weil wir etwas Lustiges über Bild schreiben.
Passt Idealist besser als Chronist?
Ja. Darf ich das nachträglich nehmen?
Angenommen, Sie wären Chef einer großen Tageszeitung. Würden Sie einen Redakteur einstellen, der bei Bild gearbeitet hat?
Das kommt auf den Einzelfall an. Halb im Scherz könnte ich sagen, man muss diesen Menschen ja auch eine Perspektive geben. Ihnen Wege aufzeigen, aus dem Unrechtssystem Bild herauszukommen.
Und Ihre Perspektive? Wenn man böse wäre, könnte man sagen, Sie haben schon fast Ihr ganzes Leben lang genörgelt, was wollen Sie denn als Rentner noch machen?
Vielleicht werde ich dann zum positiven Menschen, weil ich mich so ausgenörgelt habe, und schreibe Rosamunde-Pilcher-Romane. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich.
Aus: „Klartext — Das Magazin der Deutschen Journalistenschule“. Nummer 11. Lehrredaktion 45K.