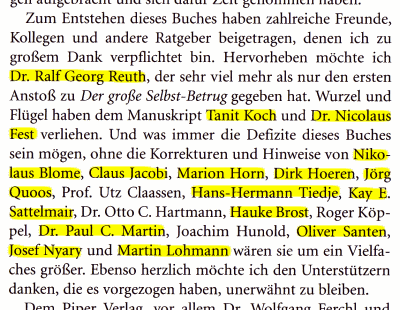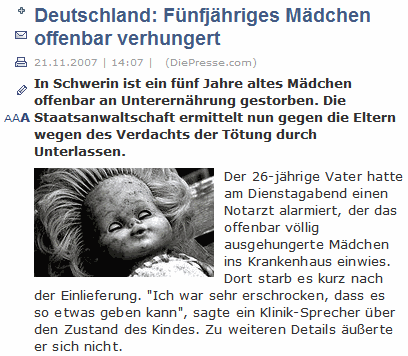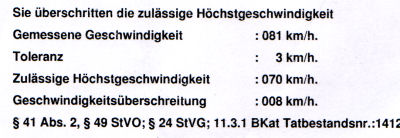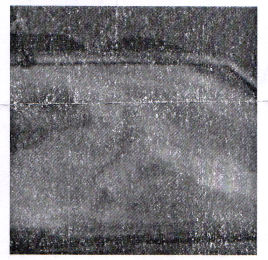Für Artikel, die irgendwelche journalistischen oder sprachlichen Mindeststandards erfüllen, scheint das Wochenende nicht ideal zu sein. Nach stern.de blamiert sich diesmal Spiegel Online mit einem Stück über die Kontroverse um die Oxford Union. Der berühmte Debattierclub der Universität hat den verurteilten Holocaust-Leugner David Irving und den Chef der rechtsextremen BNP, Nick Griffin, zu einer Debatte über die Grenzen der freien Meinungsäußerung eingeladen, die morgen stattfinden soll.
Spiegel Online schreibt:
Verteidigungsminister Browne und der ehemalige Staatsminister Denis McShane haben ihre Teilnahme bei der Oxford Union schon abgesagt.
Richtig ist: Sie haben wegen der Einladung Irvings und Griffins ihre Teilnahme an anderen Veranstaltungen der Oxford Union abgesagt. Zu der mit Irving und Griffin waren sie nicht eingeladen.
Spiegel Online schreibt:
Mehr als 1000 Unterschriften versammelt eine an Premier Gordon Brown gerichtete Petition, die das Verbot der Veranstaltung verlagt [!].
Die Petition rief Brown nur dazu auf, die Veranstaltung zu verurteilen.
Spiegel Online schreibt:
Für Like Tryl, den Präsidenten der Oxford Union, geht der Protest an der Sache vorbei. Die Veranstaltung solle dazu dienen, Irving und Griffin zu attackieren. „Sie am Auftritt zu hindern wird sie nur zu Märtyrern der freien Rede machen“, erklärte er dem „Guardian“.
Der Mann heißt Luke Tryl und hat das nicht dem „Guardian“ gesagt (vermutlich meint „Spiegel Online“ ohnehin den „Observer“), sondern in einer Erklärung an die Mitglieder, die er auf der Internetseite der Union veröffentlichte.
Spiegel Online schreibt:
Die Studentengewerkschaft hat eine Kundgebung im Rahthaus [!] von Oxford geplant, zu der auch Holocaust-Überlebende erscheinen sollen.
Die Kundgebung hat am vergangenen Dienstag stattgefunden.
Vielleicht wäre es ein Option, wenn die deutschen Nachrichtenportale im Internet einfach am Wochenende zumachten. Ich meine, die meisten gedruckten Zeitungen erscheinen ja sonntags auch nicht, warum sollen sich ihre Online-Ableger unnötig verausgaben?
[Mit Dank an Valentin Langen!]
Nachtrag: Spiegel Online hat teilweise nachgebessert und einen „Hinweis der Redaktion“ hinzugefügt. Als Quelle für Luke Tryls „Märtyrer“-Aussage wird nun nicht mehr der „Guardian“ genannt, sondern der „Observer“. Tatsächlich stammt sie — wie gesagt und im „Observer“ angegeben — aus seiner Botschaft an die Mitglieder, die auf der Homepage der Oxford Union steht. Vielleicht ist das aber auch egal.
2. Nachtrag: Nun stimmt’s im „Hinweis der Redaktion“, aber immer noch nicht im Artikel. Hilfe.