Mal abgesehen von allem anderen: Kann mir jemand die Symbolik erklären? (Wenn’s geht, unter Berücksichtigung der Haie.)
Best of Vorgestern: Die schnellste langsamste Show bei RTL
Mag sein, dass diese RTL-Sendung auf eine Art clever ist oder zumindest clever gemacht, wie Kollege Niggemeier sagt. Clever, weil sie die „Buzzfeedisierung des Fernsehens“ sei und mit all ihren Mini-Hitlisten das biete, womit „Buzzfeed“ zumindest im Netz und bei Teenagern supergut ankommt: kurze, schnell zu konsumierende Häppchen. Das ist Internetlogik im linearen Fernsehen.

Doch, ja, clever ist das – aber allenfalls aus Sendersicht. Weil so ein Format günstig ist. Es braucht lediglich einen Autoren, der Archiv und Internet bedienen kann, einen Cutter und einen Off-Sprecher. Kein Studio. Keinen Moderator. Nix weiter. Und fertig ist „Best of…! Deutschlands schnellste Rankingshow“, die vergangenen Sonnabend erstmals am frühen Abend lief und von der RTL meint:
Wenn Sie diese Sendung gesehen haben, können Sie wirklich mitreden.
Das ist lustig. Und Quark. Denn diese Sendung ist nicht schnell, wie es im Titel heißt; und sie erzählt nicht die „47 besten Geschichten der Woche“, wie der Off-Text flunkert. „Best of…!“ ist ein Mischmasch aus Herzschmerz-Sendung, Promi-Show, Tier-Doku, Ratgeber, Wetterbericht, ausgedachten Facebook-Postings von Stars, die sich irgendwer bei RTL für 2015 wünscht, und natürlich Crosspromotion für „Deutschland sucht den Superstar“ und „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“.
Manches davon ist tatsächlich aktuell, etliche der Geschichten aber, die da in irgendeiner Hitliste auf irgendeinem (redaktionell auserkorenen) Platz landen, sind alt, manche steinalt, und ein Video, das RTL als Wochen-Knaller verkauft, gab es schon, da quietschrauschten einige Leute noch mit Modem durchs Internet.
Beispiele gefällig? Gerne.
Die Motorradfahrerin, die hinter Leuten herfährt, die Müll aus dem Autofenster werfen? Das Youtube-Video dazu ist vom 15.9.2014. Das Model, das mit dem Kopf gegen den Außenspiegel eine Reisebusses knallt? War bereits Anfang Mai 2014 lustig. Und zu dem Hund, der einem Extremsportler zugelaufen ist und ihm nicht mehr von der Seite weicht, titelte die NZZ am 22.11.2014:

Nur anderthalb Monate später ist also auch RTL auf den Hund gekommen, was noch mal lustiger ist, wenn in derselben Sendung über den russischen Armee-Chor geunkt wird, dieser habe „erst jetzt“ eine Version des Vorjahres-Hits „Happy“ eingesungen. Off-Text RTL: „Meine Güte, die verschlafen echt alles.“
(Ach ja, die Geschichte des Studenten, der 130 Pfund abnimmt und dann seine Eltern überrascht, ist zwar neu auch nicht neu, und der Student heißt nicht „Lukas Irving“, sondern „Lucas Irwin“; und die Zwillingsschwestern, die aufgrund einer Essstörung angeblich Kerzen und Bücher verzehren, heißen nicht „Adele und Anita Murphy“, sondern „Adele Murphy“ und „Anita Smith“. Aber das nur nebenbei.)
Hatten wir auf der Liste der ältesten Geschichten eigentlich schon die ersten drei Plätze vergeben? Nein? Oh. Dann schnell jetzt:
Platz 3
Der Typ, der eine Arschbombe in den vereisten Swimmingpool macht und böse aufknallt, weil das Eis nicht bricht. Ist offenbar von 2012.
Platz 2
Der Fuchs, der kopfüber in den Tiefschnee taucht, auf der Suche nach Essen. Lief mal im WDR Fernsehen, bei Youtube ist der Ausschnitt auf 2009 datiert. Das WDR-Logo ist bei RTL noch zu erahnen.
Platz 1
Ungeschlagener Spitzenreiter. Der Werbespot, in dem sich ein Auto gemächlich durch eine malerische Landschaft schiebt, als plötzlich ein schreiendes Monster ins Bild springt – dieser Spot ist von 2004, also elf Jahre alt, Werbung für Kaffee, und wer ein Mal im Internet war, ist da mindestens drei Mal drüber gestolpert.

Kein Wunder, dass der Start für RTL eher mäßig ausgefallen ist. Wenn man der Quote glaubt, haben rund 810.000 Menschen zugesehen, ein Marktanteil von 12,3 Prozent. Andererseits könnte man, wenn man es gesehen hat, auch sagen: immerhin waren es 810.000 Menschen. Zumal der Sendetag undankbar war, nur Stunden nach den Terror-Morden in Paris.
Dass die mit keinem Wort erwähnt werden, ist jetzt nicht per se schlimm, weil nicht zwangsläufig jede (Unterhaltungs-)Sendung über die Attentate in Frankreich berichten muss. Wenn eine Sendung aber „Deutschlands schnellste Rankingshow“ sein will, mit Themen, über die gerade alle reden, und wenn diese Sendung obendrein eine Rubrik hat, die den Titel trägt: „Sechs Personen, die diese Woche einen Orden verdient hätten“ – na, wer fiele Ihnen da gerade so ein?
Nee, falsch.
RTL schlägt unter anderem vor, einen Orden an ein kanadisches Pärchen zu verleihen, das sich gerade ein Auto gekauft hat. Weil es die Luxus-Reise nach Hawaii, die es zu dem Auto geschenkt bekommen hat, nun – wow! – selbst verschenken will. (Wo man sich, laut RTL, zwinker, noch bewerben kann. Bis Donnerstag. Falls man zufällig in Alberta, Kanada lebt. Und „liebevoll“ ist.)
Naja, da ist es irgendwie folgerichtig, dass RTL im Mini-Ranking „6 Personen, die diese Woche besser im Bett geblieben wären“ den britischen Prinz Andrew auf den ersten Platz wählt, weil der gerade verdächtigt wird, eine Minderjährige missbraucht zu haben. Sie verstehen, ja? Missbrauch. Bett. Liegen bleiben. Haha.
Würde diese Sendung tatsächlich schnell und aktuell sein; wäre sie bissig, witzig, etwas klüger; und würde sie sich so etwas Skurriles wie Haltung zutrauen – dann könnte das unter Umständen sehr unterhaltsam sein. Ein Mal wagen sie es, etwas Haltung an den Tag zu legen und wählen die Kölner Anti-Pegida-Demo auf Platz 1 der Ordenswürdigen. Das war’s. Und die nächste „Best of…!“-Folge, die kommenden Sonnabend läuft, ist wahrscheinlich so schnell, dass sie jetzt schon fertig ist.
Korrektur, 14.1.2015. Die Geschichte des Studenten, der so viel abgenommen hat, ist auch nicht neu; sie lief anderswo bereits Anfang 2014. Ich habe das im Text korrigiert. (Danke für den Hinweis in den Kommentaren.) Die „Bravo“ hat die alte Geschichte übrigens Anfang Januar 2015 einfach auch noch mal gebracht.
„Bei manchen Artikeln hatten wir wahrlich das Gefühl, wir säßen quasi schon im Schützengraben“
Krautreporter
Die ZDF-Sendung „Die Anstalt“ hat im vergangenen Jahr Furore gemacht und der Satireshow eine ungeahnte Relevanz verschafft. Ein Gespräch mit den Kabarettisten Max Uthoff und Claus von Wagner und dem Redakteur Dietrich Krauss über die Ursachen von Meinungseinfalt, die Verwilderung des Diskurses und Kabarett als Gegenöffentlichkeit.

Herr Uthoff, Herr von Wagner, Sind Sie auch Charlie?
Max Uthoff: Wir sind traurig und fassungslos, aber wir können nicht zeichnen.
Sind Sie verblüfft, wer jetzt alles Charlie ist und flammende Appelle verfasst für die Freiheit und die Satire, inklusive dem Recht, auch anstößig zu sein und weit übers Ziel hinauszuschießen?
Claus von Wagner: Wir freuen uns, dass sämtliche deutschen Zeitungen erklärt haben, dass Satire – auch verletzende – nicht nur gewollt, sondern integraler Bestandteil der Meinungsfreiheit und damit der Demokratie ist. Wir überlegen uns ernsthaft, davon dieses Jahr Gebrauch zu machen.
Was ändert sich durch die Anschläge für ihre Arbeit?
Uthoff: Wir haben Frauen, Kinder, Autos und Schulden. Und versuchen im Rahmen dieser Möglichkeit weiter so frech wie möglich zu sein.
Wie war Ihr erstes Jahr in der „Anstalt“?
Uthoff: Knorke.
Wagner: „Knorke“, das reicht dir?
Uthoff: Das reicht mir. Mach du’s genauer. Wagner: Das ist die Aufgabenverteilung… Uthoff: Herr von Wagner muss differenzieren.
Wagner: Es hat uns mitten in einen Sturm hineingeworfen. Das war ziemlich spannend, wie viele Menschen unser „Kunstwerk“ aufgenommen und was sie damit gemacht haben.
Uthoff: „Kunstwerk“! Hört, hört.
Krauss: Wir sind schon sehr glücklich, dass das eine so große Resonanz hat, auch bei jungen Leuten. Dass das im Internet massenhaft rumgeschickt wird. Dass man mit sowas Altmodischem wie Kabarett und Aufklärung etwas rocken kann.
Haben Sie sich das vorher so vorgestellt?
Uthoff: Wir haben uns keine Vorstellungen gemacht. Wir konnten ja eigentlich nur verlieren, die Fußstapfen waren so groß, dass wir die Ränder nicht mehr gesehen haben, und dann haben wir gesagt: Was würde uns Spaß machen, und losgelegt, ohne auch nur einen Gedanken an die Rezeption zu verschwenden.
Aber Sie haben sich ja vermutlich ein Konzept überlegt.
Krauss: Wir wollten schon tiefer in die Themen einsteigen, kein Aktualitäts-Themen-Hopping machen, sondern hintergründiger, informativer, journalistischer sein.
Hatten Sie sich vorher überlegt, welche Wirkung Ihr Kabarett haben soll – darüber hinaus, Menschen eine Stunde lang zu unterhalten?
Uthoff: Ich mache Kabarett jetzt schon eine ganze Weile. Meine Eltern haben 1965 ein Kabarett in München aufgemacht. Ich mache mir über die Wirkungsweise von Kabarett keine allzu großen Illusionen. Umso überraschter war ich, dass Kabarett offensichtlich heutzutage wieder Diskussionen anstoßen kann, weil wir Informationen reinholen in ein Medium, in dem sie vorher so nicht diskutiert worden sind. Dass das auf so fruchtbaren Boden fällt, hat mich überrascht. Trotzdem glaube ich, werden wir die Revolution jetzt noch nicht schaffen.
Wagner: Wenn du das Kabarett herausnimmst aus seinem geschützten Raum, den Theater- und Kellerräumen, und wenn du dann diesen Flimmerkasten außen rum hast und ein Logo wie ZDF steht rechts oben in der Ecke, dann hat das plötzlich eine andere Wucht.
Krauss: Es war aber auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass man Kabarett auch mit Fakten füllen kann und nicht nur mit Gags.
Uthoff: Als mein Vater angefangen hat, gab es drei Fernsehsender und keine investigativen Magazine. Da wurden auf der Bühne Dinge diskutiert, die sonst nicht stattgefunden haben. Das machen wir jetzt auch wieder ein bisschen.
Kabarett, das die Leute so bewegt, schien es kaum noch zu geben. Entweder lachte man affirmativ unter sich über die gemeinsamen politischen Gegner. Oder es war Comedy, die nichts anderes will als die Pointe.
Uthoff: Ich glaube, es gibt genügend Kollegen, die in den letzten zehn, fünfzehn Jahren nicht weich geworden sind, sondern tolle Sachen machen. Es ist aber interessant, über die Wirkung nachzudenken, die wir anscheinend erzeugen. Diese positive Resonanz, mit der unsere Sendung aufgenommen wird, spiegelt ja eine Unzufriedenheit mit der Art der Information in anderen Bereichen wider.

Wie bewerten Sie denn die Medienlandschaft? Die These von vielen Ihrer Fans scheint ja zu sein: Die sind alle gleichgeschaltet, gekauft, und die wirklich interessanten Dinge erzählen die uns nicht.
Krauss: Ich komme ja direkt von den angeblich „gleichgeschalteten“ Medien. Ich habe die letzten zwanzig Jahre als Journalist frei für die ARD gearbeitet. Aus dieser Perspektive kann ich nur sagen: Wer mit guten Argumenten für seine Themen und Positionen kämpft, bekommt am Ende dort auch Sendezeit. Aber bei allem guten Journalismus, den es gibt, empfinde ich doch auch in der Summe als Zuschauer bei den großen, wichtigen Fragen – Sozialreformen, Rentenreformen, die außenpolitische Neuausrichtung – das Meinungsspektrum als sehr eingeengt. Das ist das Erbe dieses Wortes „alternativlos“, das bedeutet ja, bestimme Entwicklungen müssen einfach vollzogen werden. Und jeder, der das nicht tut, der hat’s nicht kapiert. Das ist ein Unbehagen, das mich schon auch vor der Ukraine-Thematik genervt hat.
Uthoff: Beim Ukraine-Konflikt kommen noch besondere Emotionen hinzu. In dem Moment, in dem Leute sterben, in dem Kriegsgefahr hochkommt, verstärkt sich das normale Unbehagen erheblich. Das war auch ein Grund für den großen Aufschlag bei den Zuschauern: Dass sie uns dankbar waren, dass wir formuliert haben, was in den größeren Medien nicht vorkommt.
Warum tut es das nicht?
Uthoff: Ich glaube nicht, dass da eine konzertierte Aktion stattfindet. Ich glaube nur, dass in manchen Redaktionen die immer gleichen Begriffe, die immer gleichen Einstellungen vorherrschen und die Journalisten in einer freiwilligen Selbstkontrolle die andere Seite nicht mehr recherchieren oder formulieren, weil sie dann das angenehme Betriebsklima stören würden.
Krauss: Viel von der Meinungseinfalt kommt vielleicht auch einfach aus Bequemlichkeit. Es gibt wohl auch im Journalismus wie überall viele Leute, die es gern bequem haben und die gängigen politischen Deutungen nicht kritisch hinterfragen.
Wagner: Ich denke, es fängt schon bei der Ausbildung von Journalisten an: Die lernen vielleicht, wie man den Redaktionsalltag beherrscht, machen tausende von Praktika und bekommen die Feedbacks dann meistens aus der Redaktion, nicht von außen. Man muss bewusst versuchen, Perspektivenverschiebungen herbeizuführen, neue Blickwinkel zu präsentieren. Das muss man aber auch wollen: dass man abweichende Meinungen schätzt und „fordert und fördert“.
Uthoff: Der Ukraine-Konflikte kannte in den Zeitungen im ersten Dreivierteljahr 2014 nur eine Sichtweise. Es hätte dem Ganzen gutgetan, die andere Seite einfach darzustellen. Man kann ja trotzdem sagen, die haben Unrecht, wir bleiben bei unserer Meinung.
Wagner: Sobald es um Krieg geht, gibt es so eine Dichotomie. Plötzlich waren Fronten da: Du bist auf der einen Seite oder auf der anderen. Allein dass du das Gefühl hast, es gibt ein Lagerdenken, verengt den Diskurs – wie Gabor Steingart im „Handelsblatt“ geschrieben hat: „auf Schießschartengröße“.
Sie haben das aber ja auch mitbefeuert. All den Leuten, die glauben, die Journalisten sind alle gekauft, haben Sie ja noch viel Munition gegeben…
Wagner: Sind wir es, die die Munition geliefert haben oder die Journalisten? Wir haben doch nur das gespiegelt, was die genannten Journalisten oder Zeitungen veröffentlicht haben.

Der Studie von Uwe Krüger über transatlantische Netzwerke haben Sie eine ungeahnte Verbreitung verschafft. Dahinter steckt auch die Unterstellung, wie Sie es jetzt in der Sendung formuliert haben: „Die sind alle im Arsch der Amerikaner.“
Uthoff: Dieser Satz ist natürlich Überspitzung. Wir machen Satire. Mein Job ist es nicht zu differenzieren. Ich finde, überspitzt konnte man das schon so sagen. Natürlich läuft man dann Gefahr, gedisst zu werden mit Schlagwörtern, mundtot gemacht zu werden als „Putinversteher“ und dergleichen. Wir haben niemals gesagt, dass wir Wladimir Putin für einen großartigen Herrscher und weisen Mann halten. Das wird uns auch nie einfallen. Aber die andere Seite zu beleuchten, führt sofort zu einer Abwehrreaktion und zu einem Mundtotmachen mit Schlagwörtern.
Wagner: Zumal der Ausgangspunkt ja eine sehr differenzierte Betrachtung war. Wir haben uns mit einzelnen Journalisten bei einzelnen Zeitungen beschäftigt. Anstatt einen sehr breiten Strich zu machen, was Kabarett sonst tut, haben wir sehr kleine Striche gemacht – über deren Zahl wir dann auch vor Gericht verhandeln mussten. Ich kenne zu viele gute Journalisten, als dass ich das Kind mit dem Bade ausschütten möchte.
Uthoff: Wir sind weit davon entfernt, die Presse pauschal zu verdammen. Wir suchen uns ein Thema raus, den Ukraine-Konflikt, dann stellen wir fest, auch durch Krügers Studie, Moment mal, kann es sein, dass die alle da in denselben Organisationen stecken, warum machen die das nicht öffentlich?
Krauss: Ein Journalist hat uns auf die Frage „Warum berichten Sie nicht über die Rechtsradikalen in der Ukraine“ gesagt: Damit würden wir ja der Putin-Propaganda Futter liefen. Wenn uns das ein Journalist sagt, das erzählt doch schon viel, wie da der Filter funktioniert. Man ordnet die Faktenwahrheit diesem Lagerdenken unter. Gleichzeitig ist es nicht so, dass wir diese Lücke füllen können. Denn die Kriterien für gutes Kabarett sind ganz andere als für guten Journalismus. Wir haben unseren Spaß dran, die Informationen, die unter den Teppich gekehrt werden, herauszuziehen und hochzuhalten. Das ist natürlich nur ein Ausschnitt. Und das muss auch noch witzig sein.
Das ist ja eine besondere Gratwanderung, wenn Sie Information vermitteln wollen. Welchen Maßstab muss man dann an Ihre Aussagen legen dürfen? Reicht es dann wirklich aus, hinterher zu sagen, naja, ist ja nur Satire, die darf verzerren; Kabarett, da darf man nicht die Genauigkeit verlangen wie von Journalismus?
Krauss: Wir sind so genau, wie das im Rahmen von Satire möglich ist. Dazu gibt es eine lange Rechtsprechung.Die Justiz unterscheidet bei Satire zwischen Tatsachenkern und satirischer Einkleidung. Das Kabarett lebt davon, Fakten zuzuspitzen, die aber müssen stimmen. Und genau diesem Anspruch sind wir laut Landgericht Hamburg gerecht geworden, da wir im Falle von Herrn Dr. Joffe eine dichte Vernetzung mit transatlantischen Organisationen haben nachweisen können. „Die Tatsache, dass es sich lediglich um sieben und nicht um acht Verbindungen handelt, (… ist) nicht geeignet, den sozialen Geltungsanspruch von Herr Dr. Joffe zu beeinträchtigen“, sagt das Gericht.
Uthoff: Wenn wir die Ukraine-Berichterstattung anschauen, werde ich praktisch gezwungen, mich im Internet auf Seiten rumzutreiben, auf denen ich eigentlich gar nicht sein will. Aber wenn ich dort als einziges den Ausschnitt zu sehen kriege, auf dem man sieht, dass ein Separatist nach dem Absturz der MH 17 in der Ost-Ukraine einen Teddy nicht nur als Trophäe hochhält, sondern sich bekreuzigt und kurz Demut und Trauer zulässt, dann frage ich mich schon, warum manche Fakten es nicht in die professionelle Berichterstattung schaffen.
Andererseits langen Sie auch grob zu. Sie haben die deutsche Presse versammelt im Schützengraben gezeigt.

Uthoff: Das war ein satirisches Bild. Und ist auf dem Höhepunkt der öffentlichen Auseinandersetzung um die Ukraine entstanden. Und bei manchen Artikeln hatten wir wahrlich das Gefühl, wir säßen quasi schon im Schützengraben.
Wagner: Bei allzu großer Differenzierung löst sich Kabarett auch irgendwann auf. Jeder „kann einen ordentlichen Puff vertragen“, hat Tucholsky in seinem berühmten „Satire darf alles“-Text 1919 geschrieben. Und: „Es leiden die Gerechten mit den Ungerechten.“ Das ist die Tradition, auf die wir uns berufen, da kommen Kabarett und Satire her. Da geht mir manchmal auch die Satire-Kompetenz bei denen ab, die das bewerten.
Machen Sie sich keine Sorgen über Beifall von der falschen Seite?
Wagner: Es ist ein Kunstwerk, das man hinstellt, und dann wird etwas damit gemacht. Gerhard Polt hat einmal in einem Bierzelt vor tausenden von Leuten einen Typen gespielt, der sagt: „Stellen Sie sich einmal so ein Alpenpanorama vor – in so einem Bild hat doch ein Neger nichts zu suchen!“ Er bekommt dafür dann in diesem Bierzelt Applaus. Damals konntest du nicht genau orten: Haben die die Satire dechiffriert? Oder es einfach überhaupt nicht verstanden? Satire läuft immer Gefahr, missverstanden zu werden.
Uthoff: Man sollte sich über die Rezeption nicht allzuviel Gedanken machen, sonst versucht man, nach den Wünschen möglichst vieler Kunden oder Abnehmer oder Zuschauer zu schreiben.
Aber es gibt nicht den Plan, im neuen Jahr eine Sendung zu machen, wo zum Beispiel den Russia-Today-Fans mal das Grinsen aus dem Gesicht rutscht?
Wagner: Wir schreiben keine Nummer gezielt, um ein bestimmtes Publikum zu ärgern. Ich mag auch Diskussionsstopper nicht. So Worte wie „Putinversteher“. Das ist ja auch, was man bei Talkshows immer wieder erlebt, dass Diskutanten reingehen mit einer festen Meinung, nur um ihr Lager zu vertreten. Ich träume davon, dass einer mal in einer Talkshow sagt: „Oh, das ist ja hochinteressant, das wusste ich nicht. Lassen sie uns dem gemeinsam nachgehen.“ Das ist auch etwas, das ich auch gern in Zeitungen mehr lesen würde, dass eine Unsicherheit spürbar wird, die klar macht, es gibt noch andere Seiten, noch andere Richtungen, in die man denken könnte.
Herr Uthoff, in einem Interview mit „Telepolis“ haben Sie gesagt: „Die Leser werden es sich nicht auf Dauer gefallen lassen, bei Kritik oder abweichenden Meinungen wahlweise ignoriert oder denunziert zu werden.“ Das war auf die Ukraine bezogen, klingt aber womöglich anders, wenn es um Pegida geht.
Uthoff: Ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen differenzierten Argumentationen und dumpfen Ressentiments. Wenn die wenigstens die Backen aufmachen und klar sagen würden, was sie wollen. Aber als Mahnwache schweigend, mit schwarz-rot-gold angemalten Kreuzen durch die Straßen ziehen, das halte ich für das Gegenteil von Diskussion und Aufforderung zur Diskussion.
Und da ist es, anders als bei der Ukraine, gut, wenn Medien eine Grenze ziehen und sagen: Hier hört unser Verständnis auf?
Krauss: Es ist ja schon merkwürdig, dass der Vorwurf der „Systempresse“, der „Einheitsmeinung“ von rechts wie von links kommt. Wir haben uns auch gefragt, ist das nun von der einen Seite gerechtfertigt und von der anderen nicht? Vielleicht besteht zu wenig Mut, sich mit neuen Gruppen wie der AfD oder mit unappetitlichen Meinungen hart argumentativ auseinanderzusetzen, statt sie nur hysterisch auszugrenzen.
Uthoff: Man kann den Ukraine-Konflikt so beurteilen, wie die großen Zeitungen das dieses Jahr getan haben, aber man soll das bitte im Kommentar tun. Aber vorher möchte ich bitte über beide Seiten informiert werden. Mich hat gestört, dass der Journalismus ein bisschen meinungslastig geworden ist und zu viele Adjektive in der normalen Berichterstattung auftauchen.
Wagner: Wo sind eigentlich die Orte, wo man Blattkritik öffentlich macht? Wo ist dieser Austausch, wo man sich selbstkritisch zeigt, anstatt sich nur zu verteidigen? Wir bräuchten Plattformen für einen Ideenaustausch, müssten transparente Kritikformen entwickeln, denn glaubwürdiger Journalismus ist das A und O unseres Gemeinwesens.
Ist denn das, was Sie machen, hilfreich?
Krauss: Auf jeden Fall sehen das die Zuschauer so. Ich finde den riesigen Abstand zum Beispiel auf dem Feld der Außen- und Sicherheitspolitik zwischen dem, was die Bevölkerung für richtig hält, und dem, was die Meinungsführer für richtig halten, für problematisch. Der muss auf irgendeine Art mal zum Ausdruck kommen. Ich vermisse, dass auch ernsthaft Argumente vorkommen, die gegen den herrschenden Kurs existieren. Die Bevölkerung muss mitgenommen oder erzogen werden. Wenn ich Sendungen wie den „Presseclub“ sehe, fällt mir oft „Samstag Nacht“ ein: Fünf Stühle, eine Meinung. Ok, ein Exot ist immer dabei.
Wagner: Kabarett gibt ja oft dem Affen Zucker. Ich ertappe mich auch schon dabei, darüber nachzudenken, ob Kabarett in einer so aufgeheizten Debatte sich vielleicht zurücknehmen muss… Aber in welcher Situation sind wir, wenn sich Kabarett und Satire überlegen müssen, ein bisschen Stoff und Zunder rauszunehmen? Wer müsste sich solche Fragen eigentlich stellen?
Krauss: Es ist wirklich ein Problem, wenn sich jeder diesen polemischen Ton aneignet, wenn dermaßen ausfällig argumentiert wird in diesen Foren, dann macht es einem schon Angst. Klar, du hast auf der Bühne eine herausgehobene Position, und es ist eine Kunstwelt, die ist geschützt, aber wenn das überall passiert, dann verwildert der Diskurs.
Uthoff: Dann müssen wir egoistisch sagen: Wir dürfen das! Das ist unsers!
Wie geht es Ihnen denn mit dem Vorwurf, dass Sie das Sprachrohr von Ken Jebsen sind?!
(Gelächter)
Wagner: Wir sind kein Sprachrohr! Ein Sprachrohr ist hohl. Wir sprechen für uns selbst.
Uthoff: Man kann unsere Sendung wirklich gern kritisieren. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und nachdenkt, kann man es auch mit handfesten Argumenten tun. Aber es wurde uns nur ohne Beleg dieses Etikett aufgedrückt. Offenbar um uns in irgendeine Ecke zu stellen.
Krauss: Eine andere Kritik war, dass wir in der Anstalt nur Schwarz- Weiß-Denken kennen ohne intellektuelle Differenzierung. Wir haben uns in der kritisierten Sendung dezidiert mit dem Sachverständigengutachten auseinandergesetzt und eine Diskussion aufgegriffen, die im „Handelsblatt“ über statistische Tricks geführt wird. Wenn das dann quasi nur so wahrgenommen wird als: „Die Anstalt“ findet die Wirtschaft böse… tja. Da beschreibt dann jemand eher seine eigenen Vorurteile als unsere Sendung
In der letzten Sendunghaben Sie auch eine Diskussion gespielt, welche Rolle man als Kabarettist einnehmen will. Wie sehr man ein Kasper ist, der Dinge tut, die niemandem wehtun, und Kapitalismuskritik übt, wie wenn man „seine Eier in Sodawasser hängt: Es bizzelt ein bisschen.“ Hat das einen ernsten Kern von einer Selbstreflektion und den unterschiedlichen Rollen, die Sie selber einnehmen?
Wagner: Ja, die gibt es aber schon immer.
Uthoff: Solange es Kabarett gibt, macht man sich Gedanken über Wirkung.
Krauss: Wir haben die Chance, Informationen oder unsere Meinung auf einer semi-prominenten Plattform darzubieten. Natürlich dreht sich deswegen die Welt nicht sofort anders. Aber man hat die Chance, in einen Meinungsbildungsprozess einzugreifen.
Wagner: Menschen schütten sich Kaffee über den Kopf. Also, das haben wir geschafft. Das bleibt.
Uthoff: Wir machen uns keine großen Illusionen über die Wirkungsweise von Kabarett, aber gerade das vergangene Jahr hat gezeigt: Ein bisschen was kann es zur Diskussion beitragen. Ich glaube, dass Kabarett ein kleiner Teil einer Gegenöffentlichkeit ist.
Wagner: Man muss schon ein bisschen Demut haben, denn man ist eine Stimme im Diskurs, und der besteht aus etlichen Stimmen. Weder haben wir die Wahrheit noch wissen wir alles besser. Wir haben unsere Kunstform, und in der bewegen wir uns, und mit der geben wir etwas in den Diskurs hinein. Was dann rauskommt, ist eine andere Frage.
Wie findet denn das ZDF das?
Wagner: Bisher unterstützen sie uns vorbehaltlos.
Uthoff: Ich hatte ja in der ersten Sendung ein Solo über Gauck, da gab es sofort den Vorwurf einer Beschädigung des Präsidentenamtes. Aber die halten uns wirklich den Rücken frei. Wir dürfen unsere Arbeit machen.
Krauss: Und auch wenn es denen inhaltlich nicht gefallen sollte, erfahren wir zumindest nichts davon.
Es gibt niemanden, der sagt: Jetzt macht doch mal ein bisschen piano?
Wagner: Es hört sich vielleicht unglaublich an, aber: Wir machen tatsächlich was wir wollen.
Uthoff: Wir haben in der Vergangenheit auch andere Erfahrungen gemacht mit kleineren Sendeanstalten. Da ging es teilweise ganz anders zu.
Ach, echt?
Wagner: Ja!
Uthoff: Da waren viele Redakteure der Meinung, sie bestimmen, was gesagt werden darf, das kriegte man dann deutlich zu spüren.
Wie groß ist denn ihr tatsächlicher revolutionärer Impetus? Herr Uthoff, auf Ihrer Homepage steht: „Seit 2007 versuche ich nun, das kapitalistische System mit den Mittel der Satire aus den Angeln zu heben.“ Das ist mutmaßlich Satire, oder?
Uthoff: Ja, aber das Schöne ist: Es ist nur mutmaßlich Satire. Ich wäre schon sehr zufrieden, wenn wir dieses System mal ein bisschen in seine Schranken weisen könnten…
Herr von Wagner hat gerade die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
Uthoff: Das tut er häufiger. Das Arbeitsprinzip ist: Ich sage, was mir in den Kopf kommt, und meine beiden Kollegen versuchen, das zurückzustutzen auf ein fernsehtaugliches Format.
Wagner: Naja, man müsste jetzt zum Beispiel den Begriff des „Systems“ diskutieren…
Uthoff: Nein, da müssen wir nicht so viel herumeiern. Es gibt ein kapitalistisches System. Davon hab ich gehört, und ich glaube, man spürt es auch.
Wagner: Na gut… (seufzt).
Breaking News: Merkel sagt zum 5. Mal, dass der Islam zu Deutschland gehört

„Spiegel Online“ macht gerade mit der Nachricht auf, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel sich den Worten des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff angeschlossen habe: Der Islam gehöre zu Deutschland. Auch die meisten anderen großen Online-Medien vermelden das groß und prominent als Neuigkeit. Die Nachrichtenagenturen haben entsprechend berichtet.
Das ist verblüffend, denn Merkel hat sich Wulffs Aussage schon kurz nach seiner berühmten Rede im Oktober 2010 zu eigen gemacht. Und seitdem immer wieder.
Natürlich ist es eine Nachricht, wenn Merkel auch und gerade in der aktuellen Debatte nach den Anschlägen von Paris diesen Satz wiederholt und damit ein politisches Zeichen setzt. Aber das ist eine ganz andere Nachricht als die, die gerade auf den meisten Nachrichtenseiten steht und so tut, als habe Merkel etwas getan, was sie vorher noch nicht getan hat.
Müsste man nicht erwarten können, dass politische Journalisten wissen, dass Merkels Satz keine Premiere ist, und das entsprechend einordnen?
[Disclaimer: Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob es wirklich erst das fünfte Mal war.]
Nachtrag, 22:40. Auf tagesschau.de ist aus der Formulierung „Kanzlerin Merkel hat sich das bekannteste Zitat von Ex-Präsident Wulff zu Eigen gemacht“ nun „… erneut zu Eigen gemacht“ geworden.
Nachtrag, 13. Januar. Die Tageszeitungen von heute:

Flausch am Sonntag (63)
[via Schulle]
Zeitungsverleger instrumentalisieren „Charlie Hebdo“-Anschlag für Kampf gegen Pegida
Diese Karikatur wird morgen als Teil einer Aktion des Zeitungsverlegerverbandes in vielen Zeitungen erscheinen:

Karikatur: Klaus Stuttmann; Quelle: BDZV
Ich halte sie für infam.
Der Vorwurf, der darin steckt, ist perfide und falsch. Er ist perfide, weil er Menschen, die friedlich demonstrieren, mit einem Verbrechen in Verbindung bringt, das sie nicht befürworten, nicht gutheißen und das nicht in ihrem Namen begangen worden ist. Und er ist falsch, weil die Zeitschrift „Charlie Hebdo“ aus Sicht der Pegida-Leute genau das Gegenteil dessen ist, was sie als „Lügenpresse“ beschimpfen.
Vielleicht sollte ich vorwegschicken: Ich habe keinerlei Sympathien für Pegida und die Ressentiments ihrer Anhänger. Ich halte, bei aller Kritik, die ich an Medien habe, die pauschale Verurteilung für falsch und den Begriff „Lügenpresse“ für inakzeptabel. (Und den Vorwurf von dieser Seite schon deshalb für grotesk, weil Blätter wie die „Bild“ den Pegida-Leuten in den vergangenen Jahren zuverlässig Treibstoff für ihre Paranoia geliefert haben.)
Aber.
Es ist idiotisch, so zu tun, als müssten sich die Pegida-Leute, die sich gerade über die Morde an den Karikaturisten von „Charlie Hebdo“ empören, dafür schrecklich verbiegen, weil sie doch eigentlich auch gegen die freie Presse seien, wie die islamistischen Attentäter. Denn aus Pegida-Sicht haben die „Charlie Hebdo“-Mitarbeiter dadurch, dass sie sich trauten, den Islam zu kritisieren — im grausamsten Sinne des Wortes: ohne Rücksicht auf Verluste — , genau das getan, was sie in den deutschen Medien vermissen und was einen erheblichen Teil des „Lügenpresse“-Vorwurfs ausmacht.
In dieser Sicht ist „Charlie Hebdo“ das Gegenteil von „Lügenpresse“; seine Mitarbeiter zahlten für ihren Mut, anders als die „Lügenpresse“ die Wahrheit zu sagen, mit dem Leben. Was nicht nur die Wut auf die Täter (und die Religion, auf die sie sich berufen) steigert, sondern auch auf die „Lügenpresse“.
Das ist nicht meine Sicht. Ich mache mir diese Argumentation auch nicht zu eigen. Aber sie hat eine innere Logik.
Äußerlich krankt die Logik natürlich daran, dass man „Charlie Hebdo“ dafür als ein islamkritisches Blatt wahrnehmen muss und nicht als ein Blatt, das sich an allen Religionen abarbeitete, an den Fanatikern, an den Mächtigen, an den Idioten — und nicht zuletzt an den Islamophoben und den Ausländerfeinden wie Marine Le Pen. „Charlie Hebdo“ ist ein Blatt, das den Pegida-Leuten nicht gefallen dürfte. Aber dadurch, dass es offenkundig einem islamistischen Attentat zum Opfer fiel, ist es leicht, sein Wesen fälschlicherweise auf die Verspottung des Islam zu reduzieren.
Es ist schon richtig: Man muss „Charlie Hebdo“ vor der nachträglichen Vereinnahmung durch Islamophobiker bewahren. Und man muss verhindern, dass die Morde der Terroristen in Paris von den Pegida-Leuten für ihre Agitation gegen Ausländer und Moslems instrumentalisiert werden.
Aber die Parallele, die die Karikatur zwischen den Worten der Pegida-Anhänger und den Taten des islamistischen Terroristen zieht, ist falsch. Und ihre Wirkung ist verheerend. Wiederum aus Sicht dieser Leute formuliert: Die deutsche „Lügenpresse“ ist nicht nur zu feige, die Wahrheit zu sagen. Sie erklärt sich nach den Attentaten sogar für solidarisch, wenn nicht identisch mit denen, die dafür nicht zu feige waren. Und erklärt stattdessen ihre Kritiker zu Komplizen der Täter.
Die Presse bestätigt aus Pegida-Sicht so, auf kaum zu übertreffende Weise, den Vorwurf von der „Lügenpresse“.
Und es kommt noch besser. Einer der Vorwürfe, die gegen die Medien erhoben werden, ist der der „Gleichschaltung“ — oder weniger problematisch formuliert: dass es in ihnen an Meinungsvielfalt mangele. Und die Zeitungen bringen nun, als Antwort darauf, gemeinsam in großer Zahl dieselbe infame Karikatur, für alle bereitgestellt vom Zeitungsverlegerverband BDZV? Und das ist klug?
Die Gemeinschaftsaktion besteht nicht nur aus der Zeichnung. Dazu gehört ein Text von Helmut Heinen, dem BDZV-Präsidenten. Er kommt daher wie einer von vielen Appellen, die man in diesen Tagen hören kann, die Meinungs- und Pressefreiheit zu verteidigen. Aber er nutzt die Tragödie von Paris in, wie ich finde, schamloser Weise, Eigen-PR für Zeitungen zu machen. Vermutlich ist es nur einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass er die Morde nicht dafür nutzt, noch einmal an die Bedeutung des Leistungsschutzrechtes zu erinnern oder die Unverschämtheit zu betonen, dass der Mindestlohn auch für so etwas immanent Kostbares und Edles gelten soll wie das Austragen von Zeitungen.
Es ist ein Dokument der Selbstgerechtigkeit. Heinen klopft sich und den seinen auf die Schulter:
In herausragender Solidarität berichten freie Medien weltweit seit Tagen über dieses unmenschliche Verbrechen (…)
Herausragende Solidarität, was soll das sein? Inwiefern ist das eine journalistische Qualität? Und: Solidarität mit wem oder was? Vielleicht am Ende: mit sich selbst?
Die Medien und gerade auch die Zeitungen tragen durch Kommentare und Hintergrundberichte zur Reflexion über unsere zivilen Standards bei.
Gerade auch die Zeitungen!
Sie sind, mit allen Fehlern und Schwächen, mit ihren Stärken und Vorzügen, eine Errungenschaft unserer Demokratie, die wir stets aufs Neue verteidigen müssen. Das zeigt nicht nur der Anschlag auf „Charlie Hebdo“. Das zeigen auch Nazi-Schmierereien an den Wänden deutscher Verlagshäuser oder das dumpfe Verunglimpfen der „Lügenpresse“ durch die Pegida-Anhänger.
Ja, auch ich sehe in dem Anschlag auf „Charlie Hebdo“ einen Anschlag auf die Presse- und Meinungsfreiheit insgesamt. Aber ich hätte davor zurückgeschreckt, von dem blutigen Gemetzel in Paris unmittelbar einen Bogen zu schlagen zu „Schmierereien“ und „Verunglimpfungen“, so lästig sie auch sein mögen. Ich glaube auch, dass es richtig ist, den Rufen von der „Lügenpresse“ etwas entgegenzusetzen, aber sie sind, so unerträglich sie sein mögen und so eindeutig ihr politischer Hintergrund ist, nicht dasselbe wie ein Mordanschlag. Einen anderen Eindruck zu erwecken, ist töricht und kontraproduktiv.
Es klingt, als würde Heinen das in diesen Tagen inflationär benutzte Bekenntnis „Je Suis Charlie“ nicht als Zeichen der Solidarität zu verstehen, sondern als wehleidiges: Ja, uns wird auch Unrecht getan, durch diese bösen Rufe auf Demonstrationen und das alles.
Die Zeitungsverleger instrumentalisieren das Attentat von Paris für ihren Kampf gegen Pegida. Ich möchte mich davon distanzieren.
- An der Aktion haben sich bisher beteiligt: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Rhein-Zeitung“, „Grafschafter Nachrichten“, „Badische Zeitung“, „Münchner Merkur“, „Mittelbayerische Zeitung“, „Thüringer Allgemeine“, „Wetzlarer Neue Zeitung“, „Kölnische Rundschau“, „Zollern-Alb-Kurier“, „Thüringische Landeszeitung“, „Mindener Tageblatt“, „Kölner Stadt-Anzeiger“, „Stuttgarter Zeitung“, „Saarbrücker Zeitung“, „Heilbronner Stimme“, „General-Anzeiger“, „Hamburger Abendblatt“,
„Welt“, „Berliner Zeitung“, „Mitteldeutsche Zeitung“, „Schweriner Volkszeitung“, „Aachener Nachrichten“, „Trierischer Volksfreund“.
[Offenlegung: Ich schreibe regelmäßig für die FAZ.]
Nachtrag, 23:45 Uhr. Der „Zollern-Alb-Kurier“ hat seinen Artikel mit der Karikatur gelöscht.
Korrektur, 10. Januar. Die „Welt“ hat sich nicht an der Aktion beteiligt, sondern Heinens Kommentar nur in einem kurzen Auszug dokumentiert.
Übrigens hat der BDZV noch eine Alternativ-Karikatur angeboten. Einige Blätter, wie die „Rhein-Zeitung“, haben diese statt der oben gezeigten abgedruckt.
Nachtrag, 11. Januar. Sehr lesenswert zum Thema:
Nachtrag, 12. Januar. Der Deutsche Journalisten-Verband DJV distanziert sich von der BDZV-Kampagne.
Weihnachtsflausch

Frohe Weihnachten!
Was mit „Wetten, dass“ stirbt: Das Genre der „Wetten, dass“-Kritik

Gehen wir zurück ins Jahr 1987 und blenden uns ein in die Rezension der damals noch an einer mittelschweren Parenthesie leidenden „Neuen Zürcher Zeitung“ über die Premiere von Thomas Gottschalk als Moderator von „Wetten, dass“:
Jedenfalls hat der ein überschweres Erbe antretende Gottschalk ein Début gegeben, das sich sehen lassen kann. Nicht mehr der mitunter enervierend „aufgestellte“ Zappelphilipp begegnete einem; zwar nicht domestiziert, aber – zu seinem eigenen Vorteil – zurückgebunden, führte er zunehmend unverkrampfter durch die Wettspielshow, liess die von ihm erwarteten sarkastischen Seitenhiebe nicht missen, dosierte sie aber unter Eliminierung jeder Schnoddrigkeit auf das zuträgliche Mass – und traf mehrheitlich ins Schwarze.
Kann sein, dass das Lampenfieber, das Gottschalk zu Beginn des Abends augenscheinlich gehörig plagte, eine heilsam dämpfende Wirkung zeitigte. Gerade die kleinen Unsicherheiten, die Versprecher, sekundenlang sichtbar werdende Hilflosigkeit, schlagen ja nicht a priori negativ zu Buche. Vielmehr dürften sie die Sympathie des Publikums erhöhen; denn wer mag schon einen perfektionierten Unterhaltungsroboter.
Gelingt es dem zweifellos über eine gute Portion Mutterwitz und handwerkliches Können verfügenden Gottschalk, weder programmierte noch programmierbare menschliche Unmittelbarkeit dieser Art beizubehalten, zugleich die paar negativ wirkenden Misstritte – etwa die abrupte Unterbrechung von Gesprächspartnern oder andere, sofort als Zeichen von Kaltschnäuzigkeit ausgelegte Ungereimtheiten im Umgang mit seinen Gästen – zu vermeiden, ist er auf einem guten Weg.
Mit „Wetten, dass“ stirbt heute auch das Genre der „Wetten, dass“-Kritik. Jemand müsste mal nachhalten, wie viele Quadratkilometer Platz dadurch jährlich in deutschen Tageszeitungen frei werden und wie viele Kapazitäten in den Online-Redaktionen. Abgesehen vielleicht vom „Tatort“ ist wohl keine Fernsehsendung hierzulande so manisch und obsessiv besprochen worden wie diese Show.
Eigentlich wollte ich zu deren Abschied eine ausführliche Würdigung des journalistischen Genres der „Wetten, dass“-Kritik schreiben. Aber der Textkorpus war einfach zu groß. Und die Auswertung zu ermüdend – auch wenn genau das das Ziel der Übung gewesen wäre: die Eintönigkeit und fehlende Originalität über die Jahre zu demonstrieren.
Sprachlich kommt an die oben zitierte NZZ-Kritik natürlich niemand heran. Allerdings bemühte sich auch die FAZ nicht unerfolgreich um eine gewisse Unverständlichkeit. In der Besprechung der ersten „Wetten, dass“-Sendung bestaunte sie am 16. Februar 1981 „die Macht des Apparates“:
Vor allem aber präsentiert das Fernsehen seine technische Potenz. Ein Computer für Zuschauervoten ist da, Direktschaltungen zu fernen Orten gelingen, Bildmontage, Verzerrer und Zeitlupe sind nötig. Aus dem bunten Abend, von dem die Unterhaltungsshow abstammt, ist ein gigantischer Jahrmarkt geworden, der etwas inzwischen Abstraktes vermitteln soll: Freude. Fast selbstverständlich sind die Mitspieler und auch der Moderator dem Apparat unterlegen: Was passiert, soll ganz unvorbereitet wirken. „Natürlich bin ich präpariert“, rief Curd Jürgens dazwischen. Die Kandidaten schmuggeln zwar noch etwas Persönliches in ihr Wettangebot ein, wie etwa die Geburtsdaten der Familie. Die Sendung aber schient etwas anderes von ihnen zu wollen, ein auf die Rolle reduziertes Verhalten. Die beiden Stars im Team mußten noch einmal ihre vergangenen „Images“ spielen, statt den dazu inzwischen gewonnenen Abstand darstellen zu können.
Vielleicht ist das der Grund, warum ihnen das Mitmachen so schlecht gelang. Frank Elstners auf Unmittelbarkeit zielende Gesprächsführung konnte sich nicht gegen den Apparat durchsetzen. Ein gieriger Zuschauer soll bedient werden, der sich am Monströsen ergötzt und alles sofort haben will.
Das Fernsehen bildet, das zeigten viele Elemente der Show, gegen die Beiträge seiner Mitspieler eine eigene Tradition aus, indem es auf frühere Sendungen zum Beispiel von Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kulenkampff und Lou van Burg zurückgreift. Es scheint so, als ginge im Verlauf dieser Tradition der Sinn der Einzelideen langsam verloren.
Sechs Jahre später verabschiedete die NZZ Frank Elstner aus der Show mit folgenden, offenkundig lobend gemeinten Sätzen:
(…) Frank Elstner ist im Grunde kein Showmaster, auch er ist nur ein Präsentator, einer jedoch, der sein Handwerk beherrscht. Dass er stets gut vorbereitet auf die Bühne kommt, dass er von seinen Gästen, die er aus den Reihen der politischen und der Bühnen- sowie der Sportprominenz holt, weiss, was es in diesen Augenblicken der Schaustellung und des leichtzüngigen Geplauders zu wissen gilt, das ist für ihn eine Selbstverständlichkeit. Und dass er dieses zugeschnittene Wissen um Personen und Situationen heiter, gelassen und gängelnd seinem Publikum vorsetzt, lässt ihn sogar als intelligent erscheinen.
Sic!
Was Frank Elstner auszeichnet, womit er spielt, das ist sein Charme, ist die Liebenswürdigkeit, mit der er auf die Menschen, die Gäste also, die wetten, aber auch und vor allem die Konkurrenten im Wettbewerb, zugeht. Er biedert sich ihnen zwar nicht an, aber er ist auf eine ganz natürliche Art freundlich mit ihnen, lässt es an Respekt nie fehlen; er bringt Respekt nicht bloss vor Leuten von politischer Prominenz auf, in diesem Fall vor Oberbürgermeister Diepgen, sondern behandelt den kleinen Mann so umgänglich wie den grossen, und wie er diesem gegenüber nie unterwürfig wird, klopft er dem anderen nie auch in misslicher Jovialität auf die Schulter.
(…) Und auch jenem Zuschauer, dem das Unterhaltungsvergnügen eines solchen Showabends eher fremd ist, empfiehlt er sich in dieser seiner Natur.
Was mutmaßlich ungefähr bedeuten sollte: Natürlich gucke ich, der NZZ-Rezent, sonst so einen Quatsch nicht. Aber auch wenn es Quatsch ist, so ist es doch – zwar, aber – ganz ordentlich gemachter Quatsch.
„Wetten, dass“-Kritiken scheinen fast vom ersten Tag Abgesänge gewesen zu sein. Als Thomas Gottschalk 1987 zum ersten Mal moderierte, begann die „Süddeutschen Zeitung“ ihre Besprechung so:
Die große Samstagabend-Familienshow ist doch längst gegessen, sagen sie alle, die beim Fernsehen für Unterhaltung zuständig sind. Ein urdeutsches Fossil ist das, woanders gibt es so was längst nicht mehr. Wenn erst der Kuli nicht mehr mag und der Carrell aufhört, ist es sowieso aus.
Und als Thomas Gottschalk 1992 zum ersten Mal aufhörte, schrieb die „Welt“:
Gottschalk tritt ab von der Bühne der Samstagabendunterhaltung. Das ist schade, weil mit ihm endgültig auch das Familienfernsehen ihr [sic!] Ende gefunden hat.
Seinen Nachfolger Wolfgang Lippert begrüßte die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ mit perfidem Lob:
Es ging nichts daneben, Lippert ist ein ausgelernter Profi des Gewerbes. Er hat es in der verblichenen DRR gelernt und praktiziert. Wir müssen uns allmählich daran gewöhnen, daß es zu den Eigenschaften totalitärer Staaten gehört, nebenbei eine Bevölkerung, die nicht viel zu lachen hat, mit ordentlich ausgebildeten Volksbelustigern bei Laune zu halten. Die Leute, die das Metier beherrschen wie Lippert, sind ganz einfach gut ausgebildet. In seinem speziellen Fall sind sie sogar auf dem Weg, richtig gut zu werden. Lippert ist schnell, sympathisch, witzig und – völlig humorlos.
Er ist ein Symptom und nicht allein daran schuld, daß einen „Wetten, daß…?“ von Sendung zu Sendung immer verdrießlicher stimmen kann.
Lippert ging wieder, Gottschalk kam wieder, und die FAZ notierte zu seiner Rückkehr im Januar 1994 sorgfältig, was er alles nicht falsch gemacht habe:
Gottschalk unterlief in der Tat kein Fehler. Er entgleiste nicht im Gespräch mit Heinz Rühmann. Den reizenden alten herrn so sanftmütig zu umsorgen zeugte von liebenswürdiger Beißhemmung. Niemand kann hier etwas einwenden. Er beleidigte keine Kandidaten, und er hatte – wohl eher Verdienst der perfekten Logistik seines Teams – mit den „Scorpions“, der am besten als Hard-Rocker verkleideten Combo der Nation, und mit Meat Loaf stromlinienförmige Musikeinlagen.
Man könnte ein Quiz machen mit Versatzstücken aus „Wetten, dass“-Kritiken und fragen, ob sie zwei, zwölf oder zweiundzwanzig Jahre alt sind und in welche Moderatoren-Ära sie gehören. Es wäre ein sehr, sehr schweres Quiz. Das hier zum Beispiel:
Eines steht fest: Hätte der immer zu Gelächter bereite Sonnyboy diese Mischung aus selbstdarstellerischen bzw. nervösen Gesten und nicht gerade von den Sitzen reißenden Wetten vor einem Monat abgeliefert, wären die Kritiker des Moderatorenwechsels in den meisten ihrer Befürchtungen bestätigt gewesen. (…) Die Diskrepanz zwischen penetranter Eigenwerbung der Prominenten aus Politik, Kultur und Sport und ihrer späteren Überflüssigkeit, die läppische Einlösung der Wetteinsätze noch innerhalb der Sendung und die an sich gut gemeinte Kinderwette, aus der aber eine Präsentation von altklugen Vorschulsonderlingen zu werden droht, ist offensichtlich nicht der Weisheit letzter Schluß.
Das würde, mit kleinsten Variationen, zu fast jedem Moderator nach Elstner passen. Es war die Kritik der „Stuttgarter Zeitung“ vom 9. November 1992, also nach der zweiten Sendung mit Wolfgang Lippert.
Oder das hier:
Weil [der Moderator] den Leuten fast auf dem Schoß sitzt, jede Fremdheit leugnend, die erst Neugier möglich macht, kann er keine richtigen Fragen stellen. So fehlen jenseits einer gewissen Flottheit des Augenblicks auch Ironie und Selbstironie in seinem Programm. Anflüge von Humor werden da schon als Höchstleistung gefeiert. Der Rest aber ist Fröhlichkeit zum Anfassen. Auch wenn man gar nicht lacht.
Auflösung: Nicht Gottschalk, nicht Lanz, auch Lippert. In der FAZ aus Anlass seiner „Dernière“ Ende 1993.
All die Abgesänge auf „Wetten, dass“, sie sind in den letzten dreißig Jahren alle schon einmal geschrieben worden. Die „Berliner Zeitung“ im November 2000:
12,8 Millionen Zuschauer, 40 Prozent Marktanteil. Blendende Zahlen für das ZDF. Wie immer mit Gottschalk.
Aber diese Ergebnisse erscheinen inzwischen wie schwerfällige Gewohnheiten, wie ein Echo, dessen kräftiger Anfangsschrei lange zurückliegt. Es ist wie mit einer Ehe, die langsam erlischt, der Sex bleibt auf der Strecke, auch wenn man noch das Bett teilt. Thomas Gottschalk hat an Qualität verloren.
Der „Tagesspiegel“ stimmte einen Monat später zu:
Man ist noch kein Denkmals-Stürmer, wenn man „Wetten, dass…?“ die Qualität des ewigen Selbstläufers abspricht. Die ZDF-Show ist stehen geblieben. Sicher, kaum ein Mega-Star, der sich nicht aufs Sofa quetschen lässt, unbestreitbar, dass Gottschalk seine Live-Sendung fest im Griff hat. Aber das Berechenbare kann auch enttäuschen. Bestimmt wird Gottschalk immer den Unsicheren geben, wenn ein Super-Super-Model auftaucht, er wird Röcke, Selbstgehäkeltes und blondes Wallehaar tragen, mit präsentem Wortwitz punkten. Die Überraschungsmomente sind ganz, ganz klein geworden. Bei den Wetten überfällt den Zuschauer immer öfter das Gefühl, mehr mit Varianten von erprobter Geschicklichkeit als mit origineller Geschicklichkeit gelockt zu werden. In der jüngsten Ausgabe wurde die Reprise einer Wette von 1983 angeboten.
Das einzige, was vielleicht noch berechenbarer war als „Wetten, dass“: die Besprechungen von „Wetten, dass“.
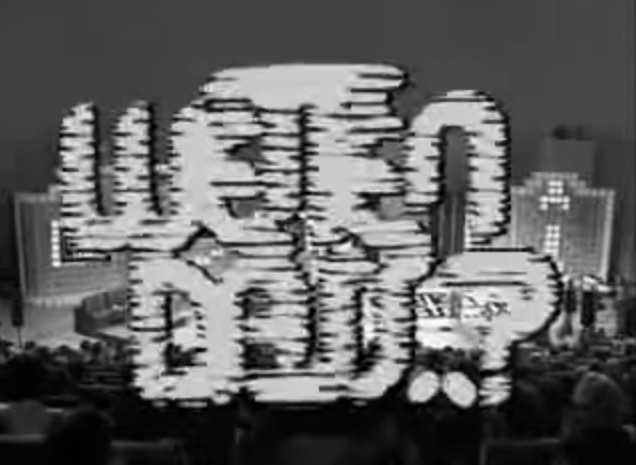
Nachtrag, 16 Uhr. Für die FAZ habe ich zum Abschied der Sendung darüber geschrieben, wie „Wetten, dass“ immer als etwas Bedeutungsvolles behandelt wurde.
Viel Nichts um Rauch
Es ist nicht das erste Mal, dass Dieter Janecek vorschlägt, den Handel und Konsum von Cannabis zu erlauben. Wundert aber auch nicht. Janecek ist Bundestags-Abgeordneter der Grünen, und da gehört es quasi zum Stellenprofil, das zu fordern. Seit gut 20 Jahren predigen die Grünen, was es für Vorteile hätte, dürfte man legal kiffen. Und diese Woche hat es Janecek geschafft, das Thema nochmal richtig prominent zu platzieren – mit Hilfe von „Bild“:

An dieser Stelle müssen wir das Gähnen kurz unterdrücken. Neu ist an dieser, laut „Bild“: neuen Steuer-Idee allenfalls, dass „Bild“ sie für neu hält. Cannabis als Genussmittel in geringen Mengen freizugeben und auf den Verkauf eine Steuer zu erheben, schlägt so ungefähr alle zwei Monate jemand vor. Was sie auch bei „Bild“ hätten wissen können, würden sie zum Beispiel „Bild“ lesen. Im Jahr 2009 sagte die drogenpolitische Sprecherin der Linken, Monika Knoche, dem Blatt:
Auch vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise halte ich eine Legalisierung von Cannabis und Marihuana für richtig. Dann hätten wir eine Gleichstellung aller Drogen und der Staat könnte durch Steuereinnahmen auch noch etwas einnehmen.
Das war natürlich eine Steilvorlage für „Bild“, die sie mit dem Slogan „Kiffen gegen die Krise“ verwandelte, weil solche Slogans immer gut kommen. Auch Janecek hatte schon mal einen, im Frühjahr, als er in der „Huffington Post“ über eine „vernunftgeleitete Drogenpolitik“ schrieb.

„Kiffen für die Kassen“ – schon mal nicht schlecht, aber so richtig geknallt hat das damals nicht, denn der Text hatte zwei Fehler: Er war nicht griffig genug. Und er stand in der „Huffington Post“.
Da hat Janecek jetzt nachgebessert. Er äußert sich in „Bild“, erreicht also viel mehr Menschen. Er formuliert knapp, offenbar einleuchtend und, ganz wichtig: Er hat einen neuen Slogan, der hübsch populistisch ist: „Kiffen für die schwarze Null“. Den hatte zwar unlängst erst das „Neue Deutschland“ als Überschrift, aber, ach: Passt schon. Immerhin ist ja die schwarze Null, also ein Verzicht auf neue Staatsschulden, populär im Moment. Angela Merkel sprach diese Woche noch auf dem CDU-Parteitag darüber, weil gerade alle darüber reden, weil Schäuble damit angefangen hat. Und Janecek – nutzt das geschickt, um sein Thema zu platzieren.
Man kenne halt Journalisten, und dann unterhalte man sich, erzähle von Themen, sagt Janecek auf Nachfrage am Telefon. Er beobachtet aus den USA, wie sich seine Steuer-Idee hierzulande verbreitet, und er kann sich freuen, denn die Deutsche Presse-Agentur griff die „Bild“-Meldung auf, und seither steht sie unter anderem bei „Stern“, „Focus“, „Abendzeitung“, „Huffington Post“ und „T-Online“.
Janecek und den Grünen kommt das zupass. Die Legalisierung weicher Drogen ist eines ihrer Kernthemen, im vorigen Jahr haben sie damit auch Wahlkampf gemacht. Und derzeit sitzen die Grünen, wie aus der Partei zu hören ist, an einem umfangreichen Gesetzentwurf zur Legalisierung, der im Frühjahr 2015 vorgelegt werden soll. Da kann es nicht schaden, schon mal ein bisschen Wind zu machen. Zumal das Thema Legalisierung, wie die schwarze Null, einen Nerv trifft: Seit ein paar Monaten wird wieder intensiv über eine Legalisierung geredet, nicht nur bei den Grünen, und nicht nur in Berlin oder Hamburg, wo Bürger über aggressive Dealer in öffentlichen Parks klagen.
Aber rechnen wir kurz nach, was uns die Grünen vorrechnen. Janecek sagt, man könnte rund 1,8 Milliarden Euro durch die Cannabis-Steuer einnehmen. Er geht dabei von rund 2,5 Millionen erwachsenen Konsumenten in Deutschland aus. Würden die im Monat je 20 Gramm verbrauchen, bei einem Gramm-Preis von sechs Euro, und würde der Staat nach Janeceks Vorschlag 50 Prozent Steuern auf den Verkauf erheben, käme man auf den Betrag. Und zu den Einnahmen könnte man nochmal so viel einsparen, sagt Janecek, da durch eine Legalisierung Polizei und Gerichte entlastet, also Kosten gesenkt würden.
Mal abgesehen von dem Fehler, dass in einem Zitat Janeceks bei „Bild“ und dpa zu viele Tonnen Cannabis pro Jahr angegeben werden, nämlich 6.000 statt 600 („Bild“ hat das inzwischen still korrigiert), hat Janeceks Rechnung an sich schon mehrere Schwachstellen.
Die Zahl von den 2,5 Millionen Konsumenten stammt aus dem aktuellen REITOX-Report der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Sie stimmt, allerdings gibt sie lediglich die 12-Monats-Prävalenz der befragten 18- bis 64-Jährigen an, das heißt: 2,5 Millionen Erwachsene haben in den zwölf Monaten vor Erhebung der Daten Cannabis konsumiert. Wie viel, sagt die Zahl nicht aus. Mal auf einer Party einen Joint probiert? Oder jeden Tag zwei Tüten aufm Sofa geperzt? Man weiß es nicht. Die Zwölf-Monats-Prävalenz weist lediglich aus, dass diese 2,5 Millionen Leute mindestens ein Mal etwas konsumiert haben. Eine Regelmäßigkeit lässt sich nicht ableiten.
Janecek rechnet trotzdem damit, dass all diese 2,5 Millionen Menschen rund 20 Gramm pro Kopf und Monat einnehmen, was als Durchschnittswert schon ganz schön hoch erscheint; außerdem stammt der Wert aus einer Studie, die 1998, also vor gut 15 Jahren, verfasst wurde, in einer Zeit, in der Cannabis noch nicht so hochpotent und wirksam war wie heute. Kurz: 20 Gramm pro Kopf und Monat, das ist nicht nur viel, sondern auch ein ganz schön oller Wert für ein aktuelles Steuerzahlenspiel. Und sechs Euro pro Gramm sind natürlich auch nur ein grober Schätzwert, der sich am Schwarzmarktpreis orientiert.
Es ist also fraglich, ob man nach einer Legalisierung, wie Janecek vorrechnet, rund 1,8 Milliarden Euro Steuern einnehmen und rund 1,8 Milliarden Euro an Polizei- und Gerichtskosten sparen könnte. Der Deutsche Hanfverband (DHV) schließt zwar nicht aus, dass es mehr sein könnte, rechnet aber zunächst wesentlich konservativer: mit rund 1,4 Milliarden Euro – und zwar für beides zusammen, neue Einnahmen und Ersparnis. Janecek kommt da auf rund 3,6 Milliarden Euro.
Cannabis zu legalisieren, birgt – neben Gefahren – natürlich Vorteile, nicht nur steuerlich. Konsumenten könnten dann zum Beispiel endlich Marihuana kaufen, das nicht, wie so oft auf dem Schwarzmarkt, mit schädlichen Streckmitteln versetzt ist. Die Debatte um eine Legalisierung ist an sich also nicht falsch, im Gegenteil: Es ist wichtig und richtig, sie zu führen. Sachlich. Befeuert man die Debatte aber, wie Janecek und die Grünen, mit einem wackeligen Zahlenspiel, schreibt das zwar ganz sicher irgendwer von „Bild“ auf und alle anderen schreiben es ab – am Ende bleibt statt Erkenntnis aber bloß viel Rauch und etwas grüner Populismus übrig.




