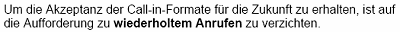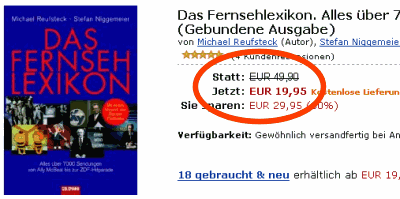Ich wäre dann gestern Morgen fast wieder bereit gewesen für neue Nachrichten. Hatte mich bei dem Gedanken ertappt, dass in diesen Tagen, in denen ich meine ganze Aufmerksamkeit auf die Niedlichkeit von diesem Knut gerichtet habe, etwas passiert sein könnte in der Welt. Dass vielleicht in der Zwischenzeit in einem anderen Zoo in einem anderen Land ein anderes Tier geboren worden sein könnte, das von einer anderen Mutter verstoßen wurde und nun von einem anderen Tierpfleger von Hand aufgezogen wird, ganz anders, aber genau so niedlich. Aber dann lief im Ersten diese neue Doku-Soap über Knut und die hatten Babyfotos von Knut, die ich noch gar nicht gesehen hatte, und einmal knabbert der Knut total süß in die Plastikschüssel, in der er gewogen wurde, und ich hatte vorher nur gesehen, wie er an den Gummistiefeln von seinem Pfleger und in seine Schmuse- und Trockenrubbeldecke knabberte, und vor allem war da diese Szene, in der der Pfleger Knut tropfnass aus der Badewanne hob und unter den Schultern packte und ausschüttelte und das war wirklich das Goldigste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
All das darf uns aber nicht daran hindern, kritische Fragen an die Medien zu stellen. Zum Beispiel: Wäre ein Rumpelsender wie N24 technisch und personell dafür gerüstet, notfalls die Live-Übertragung der ersten Pressekonferenz von Knut zu unterbrechen, wenn gleichzeitig ein Nacktnasenwombatwaisenkind im Zoo von Münster erstmals seine Augen öffnet? Kann ich mich darauf verlassen, dass mich n-tv, wenn dort gerade nur Knut-Bilder vom Vortag wiederholt werden, wenigstens im Laufband aktuell über den Grad von Knuts Niedlichkeit informiert? Wo sind die kritischen Hintergrundberichte? Wer prangert den Skandal an, dass immer noch, Tag für Tag, irgendwo in der Wildnis potentiell unfassbar niedliche Flauschzottel unter Ausschluss der Öffentlichkeit geboren werden? Wann ändert Sabine Christiansen ihr Programm und fragt nach dem Verantwortlichen dafür, dass unermessliche Niedlichkeits-Ressourcen in entlegenen Regionen ungenutzt verkümmern? Wird Volker Panzer oder Peter Sloterdijk das „ZDF-Spezial“ zur philosophischen Frage moderieren, ob ein niedliches Tier, das niemand sieht, überhaupt niedlich ist? Und: Wenn Knut in ein paar Jahren zu Reinhold Beckmann in die Talkshow geht und der ihn fragt, wie er sich fühlte, damals, als ihn seine Mutter verstieß, wie groß ist die Chance, dass er ihn statt einer Antwort auffrisst?
(c) Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung