Ich vermute, sie haben lange gefeilt bei Springers, an der offiziellen Stellungnahme der Axel Springer AG zu Alan Poseners gelöschtem Blog-Eintrag zu Kai Diekmann auf „Welt Debatte“. Bemerkenswert finde ich diesen Satz:
Der Beitrag von Alan Posener über Kai Diekmann ist ohne Wissen der Chefredaktion in den Weblog von Alan Posener gestellt worden.
Mal abgesehen von der lustigen Passiv-Konstruktion, die irgendwie die Möglichkeit nicht auszuschließen scheint, dass Unbefugte den Beitrag in Poseners Blog gestellt haben: Was heißt das: „ohne Wissen der Chefredaktion“?
Zunächst einmal heißt das natürlich: Christoph Keese ist nicht Schuld. Keese ist Chefredakteur von „Welt Online“ und Chefredakteur der „Welt am Sonntag“, wo Posener das Kommentarressort leitet, und die Axel Springer AG teilt mit: Er kann nichts dafür, er wusste von nichts. Das ist eine wichtige Information. Vor allem für Christoph Keese.
Aber wenn man Springer-Sprecherin Edda Fels beim Wort nimmt (und es gibt keinen Grund, das nicht zu tun), müssen die „Welt“-Blogger vor dem Bloggen brav der Chefredaktion Bescheid sagen.
Lieber Daniel Fiene,
lieber Don Dahlmann,
ist das so? Was bedeutet es, auf „Welt Online“ zu bloggen? Bloggt Ihr nur Dinge, mit denen Christoph Keese einverstanden ist? Habt Ihr die Springer-Leute darauf hingewiesen, dass sie Euch durch die Formulierung in eine unmögliche Situation bringen? Habt ihr da eine Freiheit beim Bloggen oder seid Ihr den gleichen, sagen wir: verlagspolitischen und arbeitsrechtlichen Einschränkungen ausgesetzt wieder jeder festangestellte „Welt“-Journalist?
Könnte es die „Unternehmenskultur“ von Axel Springer mit ihrem „Meinungspluralismus“ aushalten, wenn Daniel Fiene in seinem Medienblog (!) auf „Welt Online“ die Diskussion um den Vorfall aufgriffe? Sachlich, pointiert, wie auch immerß Und wenn er es täte: Würde dann Keese den Beitrag, bevor er in Fienes Blog „gestellt wird“, redigieren?
Die Reaktion auf die Debatte um die (Selbst-)Zensur bei Springer finde ich fast aufschlussreicher als den Akt selbst. Wie erbärmlich ist das: Die einzige Reaktion, die der Axel Springer AG auf die heftige Debatte einfällt, ist sich totstellen. So zu tun, als gebe es sie nicht.
Aber es gibt sie. Auch die „Welt Online“-Leser kennen sie. Aktuell sind die beiden meistgelesenen und meistkommentierten Blog-Einträge auf Welt Debatte zwei Einträge von Posener. Darunter diskutieren die Leser den aktuellen Fall von (Selbst-)Zensur. Aber sie diskutieren unter sich. Von Springer, von der Welt, von „Welt Online“, von „Welt“- „Debatte“ diskutiert niemand mit.
Seit drei Wochen hat Christoph Keese sein eigenes Blog. Er scheint nicht so viel zu erzählen zu haben, aber das wäre doch mal ein guter Anlass. Wofür ist sein Blog da, wenn nicht zur Kommunikation mit den Lesern? Warum kann ein Chefredakteur, dessen Beruf es theoretisch ist, zu kommunizieren (auch wenn er mir vor kurzem in anderem Zusammenhang mitgeteilt hat, weitere Kommunikation sei wegen meiner „impertinenten Unterstellungen“ und meiner „selbstgerechten Vorwürfe“ „nicht erwünscht“), warum kann dieser Chefredakteur sich nicht dem Dialog, der „Debatte“ mit seinen Lesern stellen? Warum kann er ihnen nicht erklären, warum es seiner Meinung nach die richtige Entscheidung war, Poseners Beitrag zu löschen?
Ich fürchte, bei Springers glauben sie wirklich, wenn sie Themen nur konsequent genug totschweigen, seien sie tatsächlich tot.
Sie werden sich noch wundern.
 Es gab ein paar technische Probleme mit dem
Es gab ein paar technische Probleme mit dem 


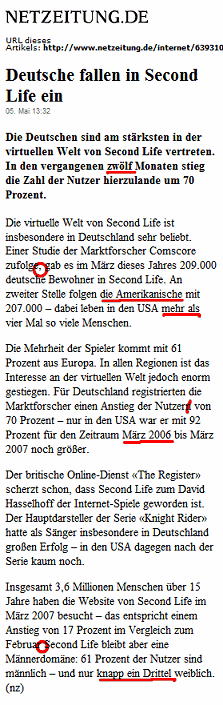 Die Zahl der deutschen Second-Life-Bewohner stieg
Die Zahl der deutschen Second-Life-Bewohner stieg