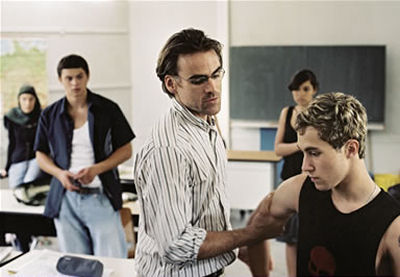Dominik Graf hat dem Grimme-Preis zum 50. Geburtstag einen Film geschenkt. Es ist ein Nachruf geworden. Ein Nachruf auf das Fernsehen. Und auf all die Träume und Versprechungen, die sich einst mit diesem Medium verbanden, seine Experimentierlust und seine Neugier, seinen Ehrgeiz und seinen Anspruch. Ein Nachruf auf all die Hoffnungen, die das Fernsehen und seine Zuschauer längst begraben haben.
Es ist ein trauriger Film geworden, aber das Traurigste sind nicht die sentimentalen Rückblicke in alte Fernsehzeiten, die nostalgischen Erinnerungen und Beschwörungen einer untergegangenen Zeit, die natürlich, und zu Recht, im Verdacht stehen, etwas zu verklären und zu idealisieren; wohlfeil zu sein in ihrer Kritik an der Gegenwart.
Das Traurigste sind die Sätze, die Fernsehmacher und Fernsehverantwortliche von heute über die Gegenwart des Fernsehmachens sagen.
Barbara Buhl sitzt da, die aktuelle Leiterin der Programmgruppe Fernsehfilm im WDR, und sie strahlt eine solche Resignation aus, dass man sich fragt, wie sie es schafft, morgens ins Büro zu gehen. Sie sind so bitter, ihre Sätze, und dabei so verblüffend offenherzig — so reden Fernsehverantwortliche sonst nicht öffentlich.
Sie sagt zum Beispiel:
Ich glaube, wir können uns gar nicht mehr so viel selber helfen. Ich glaube, man muss uns von außen dazu zwingen. Ich glaube, die Struktur ist so hierarchisch — und so komplex andererseits auch wieder, durch diese föderalen Sender- und Konkurrenzen-Gefechte um Sendeplatz und Präsenz.
Über den Jubilar formuliert sie:
Der Grimme-Preis gilt als Schutzschild, wenn man jetzt quotenmäßig, sagen wir mal, relativ wenig Erfolg hatte, dann hat man aber wenigstens einen Grimme-Preis, und man kann sich sozusagen mit den Preisen am Schluss des Jahres noch ein wenig schmücken. Aber medienpolitisch geht das nur bis zu einer ganz bestimmten Ebene, das kommt nicht in die obersten Etagen überhaupt ins Bewusstsein, glaube ich.
Der Grimme-Preis, er ist in dieser öffentlich-rechtlichen Logik eine Art Trostpreis. Die Währung, die einzige harte Währung, ist die Quote. Aber wer die nicht hat, hat mit einem Grimme-Preis wenigstens einen kleinen Zauber, mit dem er sich mit etwas Glück den Rücken freihalten kann.
Bettina Reitz, die Fernsehdirektorin des Bayerischen Rundfunks, formuliert es ähnlich:
Wenn der Film auch noch eine schlechte Quote hatte, dann konntest du nur noch auf einen Preis hoffen. Wenn du wenigstens sagen konntest: Die Quote war nicht so gut, aber der Film hat einen Grimme-Preis bekommen, dann wurdest du wieder, sozusagen, in Ruhe gelassen.
Erst wenn man die Quote weiß, kann man beurteilen, ob eine Sendung Qualität hat. Eine Beurteilung nach anderen Kriterien ist so schwer geworden, dass der Freiraum dafür mit größerer Anstrengung geschaffen werden muss, wie Reitz berichtet:
Du brauchtest irgendwo auch ein Rückgrat, indem du sagtest, jetzt müssen wir erstmal über den Inhalt diskutieren, in der Redaktion zu einer Einschätzung eines Filmes finden, und zwar unabhängig, wie die Quote sein wird. Das heißt, im Vorfeld der Ausstrahlung. Das war die einzige Rettung, die du in dieser Zeit hattest, dass man sich mit dem künstlerischen Team und den Kolleginnen und Kollegen einig war, wie wir einen Film einschätzen und auch bewerten.
Vielleicht ist es noch eine Untertreibung, wenn man sagt, dass die Quote in diesem System alles ist.
Und dann sitzt da die Produzentin Katja Herzog und sagt über ausländisches Fernsehen:
Ich bin 38, ich möchte Filme machen oder auch Serien, und mein Zuschauer, unser Zuschauer, ist eben gute 60 Jahre alt. Das heißt im Prinzip: Ich muss meinen Eltern Geschichten erzählen. Das bringt mich auch als Macher in eine gewisse Schizophrenie, weil ich ja abends nach Hause gehe, und mir Dinge anschaue, die ich liebe und von denen ich lerne und die ich auch gerne analyisere, aber am Morgen sozusagen in mein Büro marschiere und weiß, das ich das alles hinter mir lassen muss, weil: Nichts von dem, was ich toll finde, kann ich wirklich unterbringen, in dem Rahmen, der mir momentan gesteckt ist.
Ist das nicht zum Heulen?
Dominik Grafs Film macht nicht nur traurig, er macht auch wütend. Auf die ganzen selbstgemachten Zwänge, die eierlosen Entscheider, die Verhinderer.
Der Film hat mich wieder erinnert an eine Diskussion beim „Netzwerk Recherche“. Vor vier Jahren saßen Volker Herres, Programmdirektor Das Erste, und Thomas Bellut, damals noch ZDF-Programmdirektor, heute -Intendant, auf dem Podium. Markus Brauck vom „Spiegel“ moderierte, und er dachte, er versucht mal, die beiden gegeneinander aufzuhetzen. Sie dazu zu bringen, mit Leidenschaft für ihr Programm zu kämpfen und das des Konkurrenten anzugreifen. Was für ein grandioser Irrtum.
Da saßen keine zwei unterschiedlichen Personen. Da saß ein doppelter Technokrat, dessen Leidenschaft nicht irgendwelchen Programmen galt, sondern dem Audience Flow. Der versuchten, irgendwelche Teile mit irgendwelchen Inhalten so ineinanderzupuzzeln, dass da möglichst wenig ruckelte. Dass da keine Lücken oder Huckel entstanden, bei denen Zuschauer verloren gehen konnten. Es ging diesen Leuten nicht um Inhalte, sondern um Logistik. Sie hätten — so jedenfalls mein Eindruck — genauso gut Container mit Dosenthunfisch sortieren können wie Sendungen im Programmschema.
Es sind diese Leute, die konfektionieren, industrialisieren und schematisieren, auf die Dominik Grafs Film mich wieder frisch wütend macht, ihre Anspruchslosigkeit, ihre Leidenschaftslosigkeit, ihre Mutlosigkeit.
Dominik Graf erzählt Aufstieg und Verfall des Fernsehens parallel zu Aufstieg und Verfall der Stadt Marl, die auch vor noch nicht so vielen Jahrzehnten große Hoffnungen und kühne Träume hatte. Ich habe zum ersten Mal verstanden, was die Besonderheit dieser Stadt ist, über die sich so leicht lästern lässt, wenn man in irgendeinem Zusammenhang mit Grimme da zu Besuch ist und zwischen dem Beton friert.

Der schönste Teil des Films ist ein bittersüßes Märchen, das Graf von einer Fernseh-Ansagerin erzählt, Inger Stoltz (Judith Bohle), träumerisch authentisch in Szene gesetzt. Graf setzt mit der kleinen Geschichte der Ansagerin an sich ein Denkmal, und er zeigt sie als Symbol für ein Fernsehen, das noch eine persönliche Beziehung zu dem einzelnen Zuschauer aufzubauen versuchte und ihn nicht auf den Bestandteil einer unter dubiosen Umständen gemessenen Quote reduzierte. Schon für diese Geschichte lohnt sich das Einschalten.
Der Film endet mit einer wunderbaren kleinen Szene, die man gesehen haben muss, und großem, verwegenem Pathos:
„Es geht beim Fernsehen um Freiheit, um Offenheit, um das Niederlegen von Denkzäunen. Es geht um die Vernichtung von Bürokratie. Es geht um die Vermischung von Avantgarde und Popularität. Es geht schlicht und einfach um die Verbesserung der Welt.
Haltet Euch ran, Freunde.
Wir.
Waren.
Schon.
Mal.
Mit.
Allem.
Wesentlich.
Weiter.
Der Film „Es werde Stadt“ von Dominik Graf und Martin Farkas zum Zustand des Fernsehens in Deutschland aus Anlass des 50. Grimme-Preises wurde von vier Rundfunkanstalten der ARD koproduziert. Er hat deshalb das Privileg, in den nächsten Wochen gleich viermal zu sehen zu sein: WDR, heute, 23:15 Uhr; NDR, Dienstag auf Mittwoch, 0:00 Uhr; SWR, Mittwoch, 23:30 Uhr; BR, 3. Juni, 22:45 Uhr.
Dass die ARD diesen Film auf einem ihrer 3000 Kanäle zu einer Zeit zeigen könnte, bei der der Zuschauer nicht bis nach Mitternacht aufbleiben muss, ist natürlich unvorstellbar.