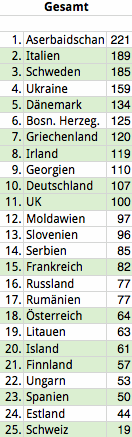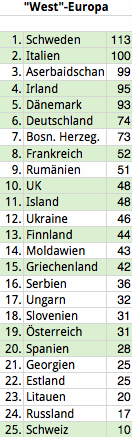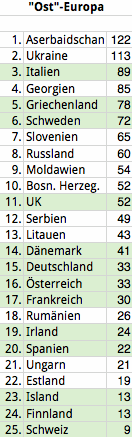Das Konzert „Sing for Democracy“, mit dem Bürgerrechtler und Oppositionelle im Vorfeld des Eurovision Song Contest für Meinungsfreiheit in Aserbaidschan werben wollen, wird nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Die Regierung in Baku hat entsprechende Anträge abgelehnt. Gleich acht verschiedene Plätze hatten die Organisatoren vorgeschlagen — ohne Erfolg. Nun muss die Veranstaltung am kommenden Sonntag in einem Musikclub stattfinden.
Damit ist ungefähr nichts übrig von der Illusion, die Aufmerksamkeit rund um den ESC werde das autoritäre Regime in Baku dazu bewegen, sich wenigstens ein bisschen kompromissbereit, friedlich oder demokratisch zu geben. Natürlich hätte die Regierung auch ein Zeichen setzen können und einige politische Gefangene freilassen. Aber sie wusste wohl, dass das nicht nötig war.
Die Regierung zeigt, was sie darunter versteht, einen guten Eindruck zu machen: Nicht das Zulassen von Widerspruch. Sondern die möglichst umfassende Illusion, es gäbe keinen.
Die Fassaden stehen.
„Hübsch“, lautete das erste öffentliche Urteil von Jan Feddersen, der für den NDR über den ESC bloggt, über die Stadt nach einem knappen Tag Anwesenheit und einer Fahrt im Shuttlebus. „Wahrscheinlich darf man das nicht offen aussprechen“, fügte er hinzu, „weil wir doch in Deutschland so heftig über Boykott, Ächtung bis hin zur Disqualifikation debattiert haben.“ Als sei Deutschland das Land, in dem man Dinge nicht offen aussprechen darf. Und als sei es die Schönheit der Fassaden, die heftig debattiert wurde, und nicht der Dreck dahinter und die Brutalität, mit der sie errichtet wurden.
Die Logik, auf die sich viele Journalisten, Fans und Kritiker im Vorfeld einigen konnten, lautete: Es sei gut, wenn möglichst viele Leute nach Baku fahren und sich vor Ort ein eigenes Bild machen. Aber die Leute, die jetzt in Baku sind, sehen natürlich vor allem: die Fassaden.
Genau dafür wurden sie ja errichtet. Und sie sind wirklich eindrucksvoll. Baku ist überwältigend spektakulär. Die weiten Parks, die aufs Adretteste renovierte Altstadt, die Licht- und Wasserspiele überall, die Protzbauten aus unterschiedlichsten Epochen. Die Kontraste hier waren immer schon eindrucksvoll, jetzt ist die Stadt auch eine Leistungsschau für modernste, gewaltigste Architektur.

Unfassbar, wie die drei gerade fertig gestellten Flammentürme über der Stadt thronen. Sie wirken, als hätten Riesen sie einfach aus der Luft in die Stadt geworfen. Nachts zaubern zehntausende LEDs auf die Fassaden lodernde Flammen oder die Silhouette von Menschen, die die aserbaidschansiche Flagge schwenken. Die Kristallhalle leuchtet und glitzert nicht nur; riesige, bewegte Scheinwerfer markieren ihre Position im Himmel über Baku.
Ähnlich wie die Olympischen Spiele in Peking ist der Eurovision Song Contest in Aserbaidschan auch Werbung für ein politisches System, in dem die Verwirklichung großer und größter Visionen nicht durch lästige rechtsstaatliche Hürden behindert wird. Staunend flanieren Einheimische und Besucher auf dem prachtvollen Boulevard, der sich jetzt das ganze Ufer an vielen spektakulär herausgeputzten alten und neuen Gebäuden entlang bis hin zur Kristallhalle erstreckt. Sie sehen, was enorm viel Geld und fast uneingeschränkte Macht möglich machen.
Den Preis, der dafür gezahlt wurde, sieht man nicht.
Es ist ja nicht so, dass sich dieses Land für einen Besucher unmittelbar anfühlen würde wie eine Diktatur oder jedenfalls ein repressiver Staat. Es ist nicht so, dass Unrecht und Korruption einem beim Streifen durch die neuen alten Straßen mit den ganzen Läden internationaler Designer das Leben schwer machen würden, im Gegenteil.
Natürlich freuen sich auch die Bewohner Bakus, dass ihre Stadt sich so herausputzt; dass sie alles tut, um sich der Weltöffentlichkeit strahlend und modern und wohlhabend und europäisch zu zeigen. (Jedenfalls, wenn sie nicht zu den Tausenden gehören, die mit ihren Wohnungen oder ihren Geschäften dieser Verschönerung im Wege stehen.) Die Menschen freuen sich über die Aufmerksamkeit, sie sind stolz, diesen Grand Prix ausrichten zu dürfen, und in gewisser Hinsicht ist das alles sicher auch Teil der umwerfenden Gastfreundschaft, die die Aseris pflegen.
Die Summen, die Aserbaidschan direkt oder indirekt für den Wettbewerb ausgegeben haben sollen, sind atemberaubend. Einiges davon hätte die Stadt natürlich ohnehin in ihrem Modernisierungsprogramm ausgegeben; andererseits kommt anscheinend ein Teil der Mittel zum Beispiel für die Kristallhalle auch aus Etats, die eigentlich für grundlegende Sanierungsarbeiten reserviert war.

Die Innenstadt Bakus scheint vollständig dem Wettbewerb gewidmet zu sein. Überall hängen ESC-Poster und -Plakate, die kürzlich angeschafften Londoner Taxis fahren alle mit dem ESC-Logo, in den Straßen blinken aufwändige ESC-LED-Installationen.
Der Eurovisions-Zirkus, der um die Welt zieht, findet natürlich in einer Blase statt. Die Fans und Berichterstatter verbringen ihre Zeit hier in Shuttlebussen, bei Proben und auf Pressekonferenzen, auf denen es um nichts geht, schon gar nicht darum, wie die Polizei am Montag gegen Demonstranten vorgegangen ist, die für das Recht zu demonstrieren demonstrieren wollten.
Ich will das niemandem vorwerfen, ich bin ja selbst Teil davon. Es ist nur desillusionierend, in welchem Maße das Kalkül der regierenden Clique aufgeht.
Alle Teilnehmer, die auf den Pressekonferenzen gefragt werden, sagen, wie beeindruckt sie von der Stadt und allem sind. Und sie haben ja auch recht.
Ich habe ein mulmiges Gefühl hier. Nicht weil ich in irgendeiner Weise um meine Sicherheit fürchtete — als akkreditierter Journalist scheint man hier tatsächlich eine Vorzugsbehandlung zu genießen. Sondern weil es so schwer ist, nicht selbst Teil der Inszenierung zu werden, wenn man sich auf den Spaß an diesem bekloppten Wettsingen einlässt. Und weil es der Opposition so wenig gelingt, Anlässe zu schaffen, die sie sichtbar machen, kleine Störungen in der glatten Fassade, die das aserbaidschanische Regime und die Europäische Rundfunkunion EBU gleichermaßen bewahren wollen.
Dieser Eurovision Song Contest ist natürlich eine Veranstaltung, die der aserbaidschanischen Regierung dient. Wenn die EBU ihn in ihrer Mischung aus Kalkül, Feigheit und Naivität als „unpolitisch“ bezeichnet, entspricht das den Interessen der Regierung.
Die Zahl der Menschen, die hier versuchen zu demonstrieren, die Rechtsverstöße anprangern und für Bürgerrechte kämpfen, ist klein. Die Regierung hat den Menschen das Interesse an politischem Engagement systematisch ausgetrieben. Die Botschaft ist klar: Man kann gut leben in Baku, womöglich sogar immer besser dank des Ölreichtums, über den das Land seit wenigen Jahren selbst verfügen kann, wenn man sich nicht mit den Mächtigen anlegt.
Die wenigen Leute, die sich engagieren und die die Anwesenheit so vieler internationaler Gäste und Journalisten zu nutzen versuchen, um ihren Anliegen Gehör zu verschaffen, scheinen überfordert oder überlastet. Vielleicht sind sie aber auch nur chancenlos gegen die Professionalität des Apparates.
Human Rights Watch hatte die schöne Idee, einen Stadtplan von Baku für Touristen zu produzieren, auf dem nicht nur touristische Höhepunkte eingezeichnet sind, sondern auch Orte, an denen Oppositionelle überfallen oder Proteste niedergeschlagen wurden. Ich habe noch keine dieser Karten hier in Baku gesehen; ich wüsste auch nicht, wo sie zu finden sein könnten. Vielleicht ist die Regierung so erfolgreich, solche Versuche der Gegenöffentlichkeit zu unterbinden. Vielleicht muss sie sie gar nicht unterbinden, weil ihre Gegner so schlecht organisiert sind.
Überall ist Polizei. Als wir nach unserem Flug über Istanbul nach Baku gegen drei Uhr morgens in unserem kleinen Hotel ankommen, sitzen im winzigen Foyer vier Uniformierte. Ich weiß nicht, ob sie da sind, um uns zu beschützen oder andere vor uns, aber einer ist immer da. Meistens fläzen sie sich auf den Sofas und beobachten uns beim Ein- und Auschecken, mindestens einer lungert vor dem Haus herum und unterhält sich mit Kollegen. In jedem Shuttle-Bus sitzt vorne ein Beamter, auf jeder größeren Straßenkreuzung steht ein Streifenwagen, jeder Delegationsbus wird von einem Polizeiauto begleitet, Sicherheitsleute patroullieren durch die Parks, schreiten beim Filmen von Sehenswürdigkeiten ein, stehen zu Dutzenden an neuralgischen Umsteigepunkten herum.
„Vor Uniformierten muss man in Aserbaidschan keine Angst haben“, sagt der dapd-Korrespondent vor Ort, und für ihn gilt das bestimmt. „Baku ist eine sehr sichere Stadt“, lobt der Grand-Prix-Oberverantwortliche Jon Ola Sand, und das trifft zweifellos zu. Wie man auch in Polizeistaaten gewöhnlich Kriminalität nicht fürchten muss, solange man damit nicht die des Staates meint.
Ich will das Land nicht dämonisieren. Das hier ist nicht eine Art Nordkorea mit Geld. Und darin, dass Aserbaidschan seine Zukunft in Europa sucht, steckt ja eine große Chance, wenn Europa umgekehrt das Land nicht nur als Öl-Lieferanten und Geschäftspartner sieht, sondern selbstbewusst für seine Werte und Fundamente wirbt und einsteht. Das müsste man dann aber auch tun.
Gestern hat in Baku eine Konferenz stattgefunden, zu der die Opposition eingeladen hatte. Ich war leider nicht vor Ort, aber es muss ein Spektakel gewesen sein. Überraschend hat die Regierung mehrere Vertreter geschickt, was sensationell ist, weil beide Seiten seit Jahren nicht an einem Tisch gesessen haben. Andererseits sagt die Art, wie sie dann miteinander geredet haben, viel über den trostlosen Zustand der politischen Kultur im Land aus. Vertreter der Regierung und regierungstreue Journalisten beschimpften die Kritiker und Bürgerrechtler und griffen auch den deutschen Vertreter von Reporter ohne Grenzen an.
„Es sollte aussehen wie ein Dialog, aber es war kein Dialog“, fasste der Moskauer ARD-Korrespondent Georg Restle die Veranstaltung in der „Tagesschau“ zusammen.
Die Blogger vom „Vorwärts“ waren vor Ort und berichteten über den bezeichnenden Umgang mit der Journalistin Khadijah Ismayilova, die mit heimlich in ihrer Wohnung aufgenommenen intimen Bildern erpresst wurde. Kurz darauf wurde ein entsprechendes Video ins Netz gestellt, regierungsnahe Zeitungen machten es bekannt.
Khadijah Ismayilova hatte aufgedeckt, dass die Präsidentengattin, der laut aserbaidschanischem Recht Firmenbeteiligungen untersagt sind, in Panama unter 5 Firmen registriert ist. Sie ist sich deshalb sicher, dass hinter der Diffamierungskampagne das Ministerium für nationale Sicherheit beziehungsweise die Staatskanzlei des Präsidenten stecke.
An dieser Stelle gab es lautstarke Tumulte der Regierungsfreunde im Saal; ein Vertreter des Justizministeriums erdreistete sich nicht, der Journalistin die Schuld an dem Video selbst zuzuschieben, indem er betonte, wie konträr ihre moralische Einstellung doch zum Rest der Frauen des Landes stünde.
Ihr Privatleben sei ihre Sache, konterte die Journalistin. Nein, erwiderte ein Vertreter des Regierungssenders, sie habe schließlich auch über die Familie des Präsidenten geschrieben.
Aber wer will diese Geschichten hören? Das Thema Menschenrechte ist durch. Leute wie Jan Feddersen haben es ohnehin fast ausschließlich auf abstrakte Art behandelt. Er verbrämt die menschlichen Schicksale hinter kunstvollen Formulierungen wie: „Dass da einige Häuser auf demokratisch unschöne Weise geräumt werden mussten… “ Er schreibt von der „miesen Menschenrechtslage“ und dass er es „ziemlich verdienstvoll“ findet, „menschenrechtlich Kritik zu üben“. Er spricht unkonkret vom „Anliegen der Menschenrechte“ und davon, dass „kein Land zuvor, gerade was die menschenrechtspolitischen Belange anbetrifft, so sehr mit Aufmerksamkeit bedacht worden“ sei. Er verspricht, die „Menschenrechtsangelegenheiten in Aserbaidschan, ja, in der ganzen Welt heftig im Auge (zu) behalten“. Die Menschenrechtsangelegenheiten!
Feddersen nennt die Fixierung auf das Thema Menschenrechte einen „Medienhype“ und entsprechende Journalisten „politisch beinah Übersensibilisierte“. Er plädiert dafür, Länder wie Aserbaidschan am ESC teilnehmen zu lassen, weil man dann „bis zum Finale alle Probleme und Missstände prima erörtern kann“. Wenige Absätze weiter fragt er dann: „Täuscht mich der Eindruck oder ist es nicht so, dass von nun an alle vor allem Glamour und Entertainment in den Berichten erwarten (…)?“
Thomas Mohr, der für NDR 2 vom Grand-Prix berichtet, kommentiert in Feddersens Blog: „Ich lass mir die Freunde am ESC auch nicht verbieten, so sehr mir das Wohlbefinden aller Menschen in Aserbaidschan natürlich am Herzen liegt.“ Ich wüsste gerne, woher diese Leute das Gefühl haben, dass sie es sind, denen in Aserbaidschan etwas verboten wird.
Ich kann und will niemandem etwas verbieten (außer vielleicht diese „Darf man nicht mal mehr Freude haben“- oder „Darf man Baku hübsch finden“-Rhetorik, die auf perverse Weise uns zu Opfern macht). Ich stelle nur fest, dass meine Freude an dieser wunderbar albernen Veranstaltung in diesem Jahr getrübt ist. Es hat mir niemand das Feiern verboten und ich darf auch mit dem kindlichem Staunen, mit dem ich immer schon vor LED-Wänden stand, die Flammentürme bewundern. Es gelingt mir einfach nicht so gut, das unbeschwert zu tun.
Das ist die Mulmigkeit, die ich meine. Und die ein eigentlich unbeschwertes, vierteljournalistisches Format wie unser Videoblog vom Grand-Prix zu einer Gratwanderung macht.
Die umfangreiche Berichterstattung aus Anlass des Grand-Prix über die wahre Natur des Regimes hat sicher dazu beigetragen, dass die Arbeit der PR-Agenturen und Lobbyisten, die international für die aserbaidschanische Regierung arbeiten, eher schwerer geworden ist. Andererseits sieht es nicht so aus, als ob der Grand-Prix den Anstoß für irgendwelche demokratischen Fortschritte im Land geben würde. Vielleicht wäre es ein erster Schritt, sich von dieser Illusion zu verabschieden.

Der Shuttle-Bus, der uns von unserem Hotel über die brandneue, achtspurige Straße an den Rand des Geländes mit dem Nationalen Flaggenmast und der Kristallhalle bringt, hält exakt an der Stelle, an der die Häuser standen, deren verzweifelt um ihr Recht kämpfende Bewohner ich im Januar kennen lernen durfte (und aus dem das Foto oben entstand). Die Tefloniker von der EBU sagen, sie hätten sich sogar Satellitenbilder zeigen lassen, die beweisen, dass dort, wo jetzt die Halle steht, vorher nichts war. Was dort war, wo jetzt die Zufahrtsstraße zu dieser Halle ist, hat sie nicht interessiert.

In der Tasche, die alle hier bei der Akkreditierung im Pressezentrum bekommen, steckt ein Briefbeschwerer mit etwas Öl im Inneren — eine freundliche Aufmerksamkeit des Eurovisions-Sponsors Socar, der staatlichen Ölgesellschaft Aserbaidschans. Das ist dieselbe Firma, deren Sicherheitsleute im April in den beinahe tödlichen Angriff auf einen bekannten kritischen Journalisten verwickelt waren.
Nachtrag, 20. Mai. Jan Feddersen hat eine Art Antwort auf diesen Eintrag geschrieben, obwohl er nichts davon verstanden hat.