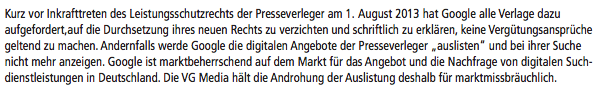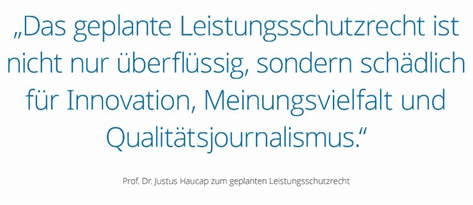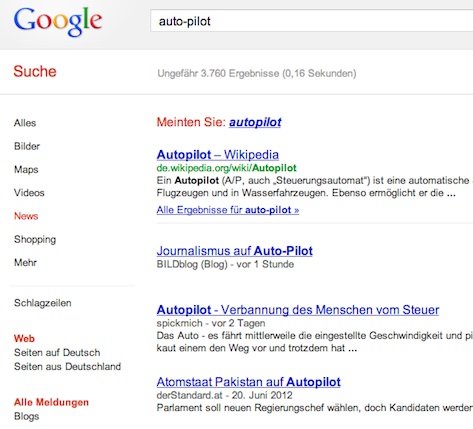Abbildung: Werbe-Broschüre der Verlegerverbände VDZ und BDZV
Das Leistungsschutzrecht für Presseverleger beschäftigt wieder einmal den Deutschen Bundestag. Morgen berät der Rechtsausschuss über einen Gesetzesentwurf von der Linken und den Grünen, der die Aufhebung des Gesetzes vorsieht. Die bereits vorliegenden Stellungnahmen von Sachverständigen kommen zu vernichtenden Urteilen über das Leistungsschutzrecht. Trotzdem werden Union und SPD wohl gegen seine Abschaffung stimmen. (Nachtrag, 20 Uhr: Von den nun insgesamt sechs Stellungnahmen fallen zwei weniger kritisch bzw. abwartend/positiv aus.)
Die Anhörung morgen ist vielleicht kein schlechter Zeitpunkt, um ein Gespräch zu veröffentlichen, das ich bereits im vergangenen November mit Christoph Keese, Executive Vice President bei Axel Springer und der wohl wichtigste Kämpfer für das Leistungsschutzrecht für Presseverlage, geführt habe. Er hatte am 9. November 2014 in einem langen Blogeintrag behauptet, das Gesetz sei nicht gescheitert, „ganz im Gegenteil“. Er warf mir einen „desinformativen Medienjournalismus“ vor und überraschte unter anderem mit der Aussage, womöglich falle auch die Anzeige von Überschriften durch Suchmaschinen schon unter das Leistungsschutzrecht (und bedürfe also einer Genehmigung durch die Verlage). Zuvor hatten Politik und Verlage immer behauptet, Überschriften blieben selbstverständlich frei.
Auf meine Bitte, mir diesen Widerspruch zu erklären, lud mich Keese damals zu einem Treffen im Journalistenclub des Verlages ein. Am 11. November vormittags erklärte er mir unter anderem, warum Überschriften womöglich doch unter das Leistungsschutzrecht fallen – und warum das kein Widerspruch ist zu dem, was die Verlage die ganze Zeit beteuert hatten. Ich dokumentiere diesen Teil des Gesprächs im Folgenden nur marginal gekürzt und geglättet.
Keese begann mit einer genauen Analyse des Gesetzestextes:
Keese: Artikel 87f, Absatz 1, Satz 1. „Der Hersteller eines Presseerzeugnisses (Presseverleger) hat das ausschließliche Recht, das Presseerzeugnis oder Teile hiervon zu gewerblichen Zwecken öffentlich zugänglich zu machen“, sprich: im Internet zu verbreiten, „es sei denn, es handelt sich“ – und das ist die Formulierung, die mehr oder weniger einen Tag vor der Verabschiedung im Bundestag auf Anregung der FDP-Fraktion noch hineingekommen ist, „es sei denn, es handelt sich um einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte.“
Jetzt ist natürlich die Frage: Was sind „Kleinste Textausschnitte“? Ich bin kein Jurist, aber die Juristen, die sich mit dem Thema befassen, sagen, das ist wahrscheinlich der einzige Superlativ in einem deutschen Gesetz. Kommt natürlich sofort die Frage: Was ist ein kleiner Textausschnitt? Und wenn klar wäre, was ein kleiner Textausschnitt ist, stellt sich sofort die Frage, was wäre denn noch kleiner als klein, also der kleinste Textausschnitt. Das ist die Gesetzesformulierung.
Die Richter haben auszulegen, was das jetzt bedeutet. Wie die das auslegen werden, weiß keiner. (…) Ein Richter wird sich nach dem Willen des Gesetzgebers erkundigen, und dieser Wille des Gesetzgebers manifestiert sich vor allen Dingen in der amtlichen Begründung, die dem Gesetz angefügt ist. Und dem, was die verabschiedenden Koalitionsparteien in ihren Reden im Bundestag gesagt haben.
Der einschlägige Text in der amtlichen Begründung lautet: „Die Empfehlung soll sicherstellen, dass Suchmaschinen und Aggregatoren ihre Suchergebnisse kurz bezeichnen können, ohne gegen Rechte der Rechteinhaber zu verstoßen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mit Blick auf das Leistungsschutzrecht für Tonträgerhersteller (Urteil ‚Metall auf Metall‘ vom 20.11.2008, Az. I ZR 112/06) soll hier gerade keine Anwendung finden. Einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte“ – und jetzt kommt’s: „wie Schlagzeilen“, also Überschriften, wobei Überschrift und Schlagzeile schon gar nicht mehr unbedingt das gleiche ist, und jetzt kommt ein Einschub, „zum Beispiel ‚Bayern schlägt Schalke‘, fallen nicht unter das Schutzgut des Leistungsschutzrechtes.“ Das steht hier. Das steht hier als Beispiel. Und da steht: „Bayern schlägt Schalke.“ Da steht nicht: „Bayern schlägt Schalke nach spannendem Elfmeter-Schießen.“ Oder „mit Flanke“.
„Die freie, knappe aber zweckdienliche Beschreibung des verlinkten Inhalts ist gewährleistet.“ Dieser Satz steht im Anschluss an diesen „Bayern schlägt Schalke“-Satz. Jetzt kann man das sicherlich so auslegen, dass man sagt: Frei, knapp und zweckdienlich ist „Bayern schlägt Schalke“. Aber „in spannendem Elfmeterschießen“ ist dann schon nicht mehr knapp, sondern schon länger als knapp.
Niggemeier: Der interessante Punkt ist aber doch, dass Sie, also Sie selbst, das anders interpretiert haben. Sie haben am 1. März 2013, nach der Verabschiedung, die Rede von Günther Krings [dem stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag] dokumentiert. Haben das ausdrücklich gekennzeichnet als: Das ist der „Wille des Gesetzgebers“, und haben das selbst zusammengefasst mit den Worten: „Überschriften sollen aus guten Gründen frei bleiben“.
Keese: Damit rekurriere ich auf diese Formulierung, dieses Beispiel, was Überschriften hier sind. Der spricht von Schlagzeilen. Schlagzeilen, zum Beispiel „Bayern schlägt Schalke“.
Das heißt, sie meinen mit „Überschriften“ gar nicht „Überschriften“, sondern Sie meinen…
Keese: … im Sinne des Gesetzes.
Das haben Sie nicht gesagt. Ich kann ihnen auch noch viel Beispiele bringen. Im Februar vorher haben Sie schon gesagt: „Sicherlich hätte auch niemand etwas dagegen, wenn Überschriften frei blieben. Das war noch vor der Formulierung des Gesetzes, im Februar 2013. Mein Eindruck ist, vorsichtig formuliert: Sie haben Ihre Interpretation jetzt geändert.
Keese: Nee. Ich versuche zu unterscheiden zwischen unserer Parteienposition und einer neutralen Position, die ich auch immer der Übung wegen einnehmen kann. Was ich in meinem neuen Blogbeitrag gesagt habe, ist: Dass das strittig ist.
Aber bislang war es nicht strittig. Wer hat es bislang so interpretiert wie Sie jetzt?
Keese: Aber ich frage Sie umgekehrt: Was ist eine Überschrift?
Die Überschrift ist das, was der Verlag zur Überschrift macht. Der Verlag sagt: Dies ist unsere Überschrift. Google entscheidet das ja nicht selbst, sondern übernimmt das, was der Verlag entsprechend per HTML als Überschrift des Artikels definiert.
Keese: Ja und nein: Google liest Überschriften nur bis zu ungefähr 60 Anschlägen aus. Deswegen hat sich das zum Industriestandard entwickelt.
Aber die Entscheidung, was ist eine Überschrift, trifft ja der Verlag.
Keese: Ja. Aber nur mal angenommen, die Verlage würden sich, nur als Gedankenspiel, dafür entschieden haben, dass Überschriften 3000 Zeichen lang sind. Dann kann ja nicht die technische Definition des Feldes Überschrift maßgeblich sein für den Richter bei der Auslegung, was eine Überschrift ist.
Naja, es ist ja nicht nur eine technische Definition, sondern die Entscheidung des Verlegers, zu sagen: Wir wollen, dass die Überschrift aus welchen Gründen auch immer so lang ist.
Keese: Ich möchte meinen neuen Blog-Beitrag nicht so verstanden wissen, dass ich jetzt der einen Interpretation das Wort rede. Ich möchte eigentlich nur klarmachen, wie das prozessuale Vorgehen ist. Und klarmachen, dass keine der beiden Seiten weiß, wie am Ende ein Richter eine „Überschrift“ definiert. Das kann sorum und sorum ausgehen. Was uns nur im Verfahren mit dem Kartellamt verwundert hat: Das Kartellamt hat Google ziemlich deutlich indiziert, dass es unter der Nutzungsschwelle des Leistungsschutzrechtes wegtauchen kann, wenn es sich auf die Überschrift kapriziert [also nur die Überschrift anzeigt]. Und ist davon ausgegangen, dass es klipp und klar wäre, was eine Überschrift ist. Aber das ist nicht ausgeurteilt.
Aber das Interessante ist doch, dass genau Sie – sowohl Sie persönlich als auch die Verbände – genau diesen Eindruck im Vorfeld ganz massiv erweckt haben. Die Formulierung in der Informationsbroschüre von [den Verlegerverbänden] VDZ und BDZV heißt: „Es ist wichtig, die Position der Verlage im Detail zu verstehen: (…) Überschriften können frei verwendet werden.“
Keese: Überschriften im Sinne des Gesetzes.
Es gab das Gesetz aber noch gar nicht. Und da steht auch nicht „im Sinne des Gesetzes“.
Keese: Stimmt, die Broschüre war vorher, am 26. Januar habe ich den Text der Broschüre gebloggt. Das heißt, das war sechs Wochen vor der Verabschiedung [des Gesetzes]. Da allerdings kannten wir die Formulierung mit den „kleinsten Teilen“ noch nicht. Mit anderen Worten: Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, wie die Formulierung des Textes sein würde. Gemeint habe ich dann nach Verabschiedung des Textes aber immer: das, was im Gesetz steht, und das weiß ich auch nicht, wie das ausgelegt wird.
Im ganzen Vorfeld war das aber überhaupt nicht strittig. Gerade um die Besorgnis in der Fachöffentlichkeit zu beruhigen, haben die Verleger gesagt: Wir wollen gar nicht Überschriften da einbeziehen. Das heißt, wenn das Gericht sich den Kontext, den Willen des Gesetzgebers anguckt, unter anderem auch die Aussagen von Herrn Krings, findet man überall Beispiele dafür, dass die Verlage und auch die Politik gesagt haben: Nein, Überschriften meinen wir damit nicht. Und jetzt kommen Sie damit an und sagen: Hm, das ist eigentlich unerklärlich, dass das Kartellamt plötzlich so tut, als sei das schon klar, dass Überschriften frei sind. Also, Sie selber haben mit für den Eindruck gesorgt, dass das klar ist.
Keese: Gut, aber das war, wie gesagt, in der politischen Diskussion vor der Verabschiedung des Gesetzes. Ich überlege vielleicht, ob ich das Wort korrigieren sollte in meinem Blogeintrag und das Wort „strittig“ ersetzen sollte und sagen: Es ist nicht „ausgeurteilt“. Das Kartellamt ist in der Ausleuchtung des rechtlichen Raumes davon ausgegangen, dass es klar wie Kloßbrühe wäre.
Was ich leicht zu erklären finde.
Keese: Warum?
Weil, wie gesagt, in der ganzen Diskussion und Dokumentation der Absicht der Politik und der Verlage, das klar schien.
Keese: Ja. Aber die vorausgegangene Diskussion spielt in der Auslegung des Gesetzes dann eine weniger große Rolle als der Gesetzestext und die amtliche Begründung, die beigefügt ist. Deswegen: Dieses Verfahren braucht einfach Raum und Ruhe.