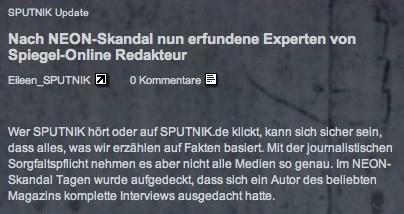Dreieinhalb Jahre lang haben Gaby Köster und ihr Management fast jeden Bericht über ihre schwere Erkrankung juristisch verhindert. Nun hat sie ein Buch über ihr Schicksal geschrieben und wirbt dafür, indem sie in einer Vielzahl von Medien und Talkshows all das erzählt, was sie vorher verbieten ließ. Wer dabei einen üblen Beigeschmack empfindet, soll sich von mir aus daran elend verschlucken.
Gestern hatte die Komikerin bei „Stern-TV“ ihren ersten Fernsehauftritt seit einem Schlaganfall im Januar 2008. Ihre linker Arm ist gelähmt, auch ihr linkes Bein hat sie immer noch nicht ganz unter Kontrolle. Gehen und Stehen fällt ihr schwer; ihr Gesicht wirkt um Jahrzehnte gealtert. Als ihre Begleiterin erzählt, dass sie Fortschritte mache, sagt Gaby Köster mit ihrem brutalen Gaby-Köster-Humor: „Ja, noch mehrere hundert Jahre, dann geht es vielleicht wieder.“ Sie raucht — „weil das was ist, was ich alleine machen kann“.
Sie soll in den nächsten Tagen noch beim „Kölner Treff“, bei „Volle Kanne“ und bei „Tietjen & Hirschausen“ auftreten sowie im November bei „Riverboat“. Sie hat mit der „Bild der Frau“ über ihre Erfahrungen gesprochen und mit dem „Stern“, der daraus eine Titelgeschichte gemacht hat.
Es gibt Leute, die ihr das nach der vorherigen Nachrichtensperre übel nehmen. Journalisten, vor allem. Man kann ein Beleidigtsein sogar zwischen den Zeilen einer dpa-Meldung erahnen, die erst Kösters PR-Termine aufzählt und dann anfügt:
Gegen die Berichterstattung über ihre Krankheit hatte sich Köster vor mehr als drei Jahren noch juristisch gewehrt. Jetzt tritt sie selbst damit in die Öffentlichkeit und vermarktet gleichzeitig ihr Buch „Ein Schnupfen hätte auch gereicht – Meine zweite Chance“.
„Welt Online“ vermutet, dass Gaby Köster „nicht gut von einem Management beraten war, das eine völlige Informationssperre verhängte“. „Focus Online“ spricht von einer „Medien-Strategie, die zumindest fragwürdig ist“. Und in einem selbst für „Meedia“-Verhältnisse erbärmlichen Artikel stellt die Autorin Christine Lübbers „einen seltsamen Beigeschmack“ fest. Sie spekuliert, die Buch-PR „dürfte zumindest bei den Medien für Verwunderung und Diskussionen sorgen, die zuvor Unterlassungserklärungen im Zusammenhang mit der Krankheit Kösters abgegeben haben“.
Es scheint für diese beleidigten Journalisten unmöglich, die Wahrheit zu akzeptieren: Gaby Köster darf selbst entscheiden, wann und wie sie die Öffentlichkeit über eine Erkrankung informiert. Das ist ihr Recht, und zu diesem Recht gehört nicht nur die Möglichkeit, Berichterstattung zu unterbinden, sondern auch die Freiheit, sie wieder zuzulassen und sogar zu forcieren. Den Zeitpunkt, zu dem sie das tut, darf sie frei wählen und sich dabei ganz von der Frage leiten lassen, was für sie ideal ist — persönlich, gesundheitlich, geschäftlich.
Es ist, auch wenn sie eine Person der Öffentlichkeit war, wenigstens bei etwas so Intimem wie einer Krankheit: ihr Leben. Es gehört nicht „Bild“, nicht ihren Fans und schon gar nicht „Meedia“.
Natürlich ist es zulässig, jetzt öffentlich zu diskutieren, ob das Vorgehen von Gaby Köster oder ihrem Management und ihren Anwälten geschickt war — geschickt im Sinne von: günstig für Gaby Köster. Aber das Schmollen und Raunen der Medien, der implizite Vorwurf der Bigotterie, sind unangemessen und abstoßend.
Sie fühlen sich offenbar benutzt: Erst dürfen wir nichts schreiben und nun sollen wir ihr bei der PR helfen.
Nur gibt es gar keine Pflicht dazu, Teil von Gaby Kösters Vermarktungsstrategie zu werden. Niemand zwingt „Meedia“, für Kösters Auftritt bei „Stern-TV“ zu trommeln. Gaby Köster hat „Welt Online“ nicht dazu verpflichtet, in einer sechsteiligen Bildergalerie und über einem halben Dutzend Artikeln (inklusive Klickstrecke: „Die besten Überlebensmittel: US-amerikanische Forscher haben in getrockneten Apfelringen einen starken Cholesterinblocker gefunden“) über Kösters Rückkehr in die Öffentlichkeit zu berichten. So unvorstellbar das insbesondere für die meisten Online-Redaktionen zu sein scheint: Es gäbe die Möglichkeit, darüber nicht zu berichten.
Wenn die „Meedia“-Beigeschmackstesterin fragt:
„Wenn all das über lange Zeit als Privatsache geschützt wurde, warum soll nun plötzlich und quasi auf Knopfdruck alles wieder von öffentlichem Interesse sein?“
Lautet die Antwort: Weil sie, erstens, jetzt gerade gesund genug ist, das auszuhalten, und es, zweitens, ihre verdammte Entscheidung ist.
Der stellvertretende Chefredakteur von „Meedia“ fragt dann in den Kommentaren unter dem Beitrag noch:
gelten für Krankheiten andere Spielregeln der Berichterstattung? (…) Wann werden aus Personen öffentlichen Interesses wieder private Personen? Und wann werden sie wieder öffentlich? Wer legt das fest?
Er nennt das „offene Fragen“, dabei sind sie längst beantwortet — von Gerichten und vom Deutschen Presserat, der feststellt: „Körperliche und psychische Erkrankungen oder Schäden fallen grundsätzlich in die Geheimsphäre des Betroffenen.“ Das Wort „Geheimsphäre“ ist dabei kein Synonym für „Privatsphäre“, sondern ein noch stärker geschützter Bereich.
Aber selbst wenn die Journalisten von „Bild“, „Meedia“ & Co. das verstünden, würden sie es nicht akzeptieren.
Im „Focus Online“-Artikel sagt ein Medienethiker, der „Kommunikationsberuf“, den Köster als „TV-Unterhalterin“ ausübe, bringe „doch gewisse Pflichten mit sich“. In vielen Varianten heißt es dort, das Management hätte doch wenigstens kurz sagen können, dass Gaby Köster krank ist, aber lebt. Schon Anfang 2009 schrieb „Focus Online“, die Fans wollten doch „nur etwas mehr Gewissheit. Wird die Kabarettistin jemals wieder auf einer Bühne stehen?“ Diese „Gewissheit“ hätte sicher auch Gaby Köster gerne gehabt. Vor allem aber: Was für eine rührende Naivität, zu denken, die Medienbranche funktioniere so, dass man den Leuten von „Bild“ oder RTL einen kleinen Informationsbrocken hinwirft und die sich dann damit zufrieden geben und nicht weiter versuchen, Schnappschüsse von Frau Köster im Rollstuhl zu erhaschen.
Die ganze Infamie von „Meedia“ in einem Satz:
Und mancher wird sich fragen, ob die juristische Unterdrückung der Berichterstattung nicht vor allem dazu gedient haben könnte, die Ware Information in dieser Sache über einen langen Zeitraum künstlich zu verknappen, damit anschließend der Aufmerksamkeits- wie Vermarktungswert der Story umso größer ist.
Auf welchen Zeitraum mag sich Frau Lübbers beziehen? Meint sie, die Berichterstattung wurde unterdrückt, als Gaby Köster noch im Krankenhaus zwischen Leben und Tod war, um bestens gerüstet zu sein für den Fall, dass sie ein Buch schreiben will, für den Fall, dass sie überlebt? Oder während der Zeit, als sie daran arbeitete, in ein Leben zurückzufinden, in dem sie die überhaupt in der Lage sein würde, ein Buch zu schreiben?
Und selbst wenn es so wäre, dass die ganze Informationswarenverknappung nur dazu gedient hätte, den Vermarktungswert zu steigern — wäre das nicht legitim? Gaby Köster hat sich den Schlaganfall ja nicht ausgesucht, um ihrer Karriere eine originelle Wendung zu geben. Sie habe, sagt sie im „Stern“, in den vergangenen dreieinhalb Jahren, ihre „Rente verblasen“. Es ist völlig unklar, ob sie je wieder in ihrem Beruf als Komikerin oder Schauspielerin arbeiten kann. Kann man ihr es dann nicht gönnen, wenigstens das meiste aus diesem Buch herauszuholen?


 Es geht um die Titelseite hier rechts vom 22. April. Jörg Thomann hatte damals in seiner
Es geht um die Titelseite hier rechts vom 22. April. Jörg Thomann hatte damals in seiner  Kurz zuvor
Kurz zuvor  Natürlich hielt sie das nicht ab, sich neue irreführende Schlagzeilen auch über Jauch auszudenken. Hinter dem „Kinder-Drama“ und der „bitteren Wahrheit über die Herkunft seiner Töchter“ steckt die bekannte Tatsache, dass seine Adoptivtöchter in Russland geboren wurden.
Natürlich hielt sie das nicht ab, sich neue irreführende Schlagzeilen auch über Jauch auszudenken. Hinter dem „Kinder-Drama“ und der „bitteren Wahrheit über die Herkunft seiner Töchter“ steckt die bekannte Tatsache, dass seine Adoptivtöchter in Russland geboren wurden. Das „Drama“, das sie sich im Januar ausdachte und sie „Tu’s nicht!“ ausrufen und „Trennung vom Glück?“ fragen ließ, besteht darin, dass es Stimmen gibt, die Jauchs Vertrag mit der ARD kritisieren. Wie Jörg Thomann halbbedauernd schrieb: „Debil, keine Frage, aber wohl nicht gegendarstellungsfähig.“
Das „Drama“, das sie sich im Januar ausdachte und sie „Tu’s nicht!“ ausrufen und „Trennung vom Glück?“ fragen ließ, besteht darin, dass es Stimmen gibt, die Jauchs Vertrag mit der ARD kritisieren. Wie Jörg Thomann halbbedauernd schrieb: „Debil, keine Frage, aber wohl nicht gegendarstellungsfähig.“ Ich habe leider kein Archiv mit Inhalten der „Aktuellen“, deshalb kann ich nur raten, was hinter dieser Schlagzeile hier links steckt. Möglich ist alles: Dass Nachbarn von Frau Lierhaus geheiratet haben, dass sie jemanden kennt, der mal geheiratet hat, oder dass jemand geheiratet hat, der sie schon mal im Fernsehen gesehen hat. Nur dass es um die Hochzeit von Monika Lierhaus geht, das kann man so gut wie ausschließen.
Ich habe leider kein Archiv mit Inhalten der „Aktuellen“, deshalb kann ich nur raten, was hinter dieser Schlagzeile hier links steckt. Möglich ist alles: Dass Nachbarn von Frau Lierhaus geheiratet haben, dass sie jemanden kennt, der mal geheiratet hat, oder dass jemand geheiratet hat, der sie schon mal im Fernsehen gesehen hat. Nur dass es um die Hochzeit von Monika Lierhaus geht, das kann man so gut wie ausschließen. In diesem Fall gibt immerhin das Inhaltsverzeichnis einen Hinweis, welche harmlosen Tatsachen die „Aktuelle“ zu dieser Schlagzeile verdreht hat. „Glücklicher Baby-Jubel: Beim Deutschlandbesuch drehte sich alles um Kinder“, steht da. Der Eindruck, dass die schwedische Kronprinzessin Victoria und ihr Gatte jubeln, weil sie („endlich“, wie die einschlägigen Blätter seit Monaten stöhnen) ein Baby erwarten, ist ebenso gewollt wie falsch.
In diesem Fall gibt immerhin das Inhaltsverzeichnis einen Hinweis, welche harmlosen Tatsachen die „Aktuelle“ zu dieser Schlagzeile verdreht hat. „Glücklicher Baby-Jubel: Beim Deutschlandbesuch drehte sich alles um Kinder“, steht da. Der Eindruck, dass die schwedische Kronprinzessin Victoria und ihr Gatte jubeln, weil sie („endlich“, wie die einschlägigen Blätter seit Monaten stöhnen) ein Baby erwarten, ist ebenso gewollt wie falsch. Weiß jemand, was ein paar Ausgaben zuvor mit „Unser Baby“ gemeint gewesen sein könnte? Haben die beiden ein Haustier, einen Garten, irgendein Hobby, das sie (oder auch nur die „Aktuelle“) ihr „Baby“ nennen?
Weiß jemand, was ein paar Ausgaben zuvor mit „Unser Baby“ gemeint gewesen sein könnte? Haben die beiden ein Haustier, einen Garten, irgendein Hobby, das sie (oder auch nur die „Aktuelle“) ihr „Baby“ nennen?



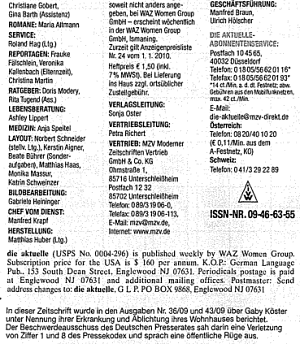
 Es ist ein groteskes Zerrbild, das Chefredakteur Peter Pauls am vergangenen Samstag in seinem Kommentar im „Kölner Stadt-Anzeiger“ zeichnet. Einerseits spielt er die spektakuläre Auseinandersetzung zwischen Konstantin Neven DuMont und seinem Vater zu einem „internen Vorgang“ herunter. „Solche Umstände“, wie Pauls sie mit erkennbarem Willen zur Verschleierung nennt, gebe es „täglich in Wirtschaftsbetrieben“. Es handele sich um eine „interne Personalie“. Andererseits tut er so, als würde ausschließlich die Axel-Springer-AG über die Vorgänge im Haus berichten, und vergleicht deren aktuelle Berichterstattung über die Vorgänge im Unternehmen allen Ernstes mit der Hetze von „Bild“ auf die Studenten Ende der sechziger Jahre. „Ununterbrochen und in kampagnenhaft anmutender Weise“ berichte das Blatt und blase die Sache zur „Staatsaffäre“ auf.
Es ist ein groteskes Zerrbild, das Chefredakteur Peter Pauls am vergangenen Samstag in seinem Kommentar im „Kölner Stadt-Anzeiger“ zeichnet. Einerseits spielt er die spektakuläre Auseinandersetzung zwischen Konstantin Neven DuMont und seinem Vater zu einem „internen Vorgang“ herunter. „Solche Umstände“, wie Pauls sie mit erkennbarem Willen zur Verschleierung nennt, gebe es „täglich in Wirtschaftsbetrieben“. Es handele sich um eine „interne Personalie“. Andererseits tut er so, als würde ausschließlich die Axel-Springer-AG über die Vorgänge im Haus berichten, und vergleicht deren aktuelle Berichterstattung über die Vorgänge im Unternehmen allen Ernstes mit der Hetze von „Bild“ auf die Studenten Ende der sechziger Jahre. „Ununterbrochen und in kampagnenhaft anmutender Weise“ berichte das Blatt und blase die Sache zur „Staatsaffäre“ auf. Er müsste sich dazu natürlich erst gegen Berndt Thiel durchsetzen, der in einer konzertierten Aktion (lustigerweise exakt das, was Pauls Springer vorwirft) am selben Tag im „Express“ einen Kommentar mit teils wortgleichen Formulierungen veröffentlicht hat. Sein Artikel beginnt mit den Worten: „Ein Vater, ein Sohn, ein Unternehmen, unterschiedliche Ansichten — ein Stoff für Schlagzeilen? Ein Stoff für Häme?“ Das fragt der stellvertretende Chefredakteur eines Blattes, das dieselben Fragen bei ungleich nichtigeren Anlässen entschieden mit „Ja“ beantwortet. Man muss ihn fast bewundern dafür, dass er sich diese Fassungslosigkeit abringen konnte.
Er müsste sich dazu natürlich erst gegen Berndt Thiel durchsetzen, der in einer konzertierten Aktion (lustigerweise exakt das, was Pauls Springer vorwirft) am selben Tag im „Express“ einen Kommentar mit teils wortgleichen Formulierungen veröffentlicht hat. Sein Artikel beginnt mit den Worten: „Ein Vater, ein Sohn, ein Unternehmen, unterschiedliche Ansichten — ein Stoff für Schlagzeilen? Ein Stoff für Häme?“ Das fragt der stellvertretende Chefredakteur eines Blattes, das dieselben Fragen bei ungleich nichtigeren Anlässen entschieden mit „Ja“ beantwortet. Man muss ihn fast bewundern dafür, dass er sich diese Fassungslosigkeit abringen konnte.