Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Vor dem Grand Prix: Besuch bei einem ehrgeizigen Volk.
Es ist, selbst wenn die örtliche Jugend gerade auf Knien und Skateboards die Rampen herunterrast, ein magischer Ort. Die Sonne taucht ihn in ihr besonderes, klares Licht, mit dem sie den Norden Europas dafür entschädigt, daß sie sich hier so selten blicken läßt. Ein steinernes Auge ragt vor der Küste aus dem Boden, starrt einen Rasenhang an, und die Dimensionen sind so gewaltig, daß man ins Grübeln kommen kann, auf welche Seite die Zuschauer gehören und auf welche die Akteure. Im Zweifelsfall läßt sich das eh nicht trennen. Ende der achtziger Jahre versammelte sich die halbe estnische Bevölkerung und lauschte nicht nur, wie es Tradition war, einem Wettstreit ihrer Chöre, sondern sang gemeinsam die verbotene Nationalhymne, um gegen die sowjetische Besatzung zu protestieren. Die „singende Revolution“.
Wer in der Hauptstadt Tallinn auf dem Sängerfeld steht, das englisch „Song Contest Grounds“ heißt, der ahnt, was es gerade für die Esten bedeutet haben muß, den „Song Contest“ der Eurovision gewonnen zu haben.
Schöne Idee, so aus der Ferne. Leider nur haben für die Esten der Schlager-Grand-Prix und die baltische Chorwettstreit-Tradition so viel gemein wie Ralph Siegel mit moderner Popmusik: nichts. Trotzdem hatte das Fernsehereignis selten für ein Land eine solche Bedeutung wie in diesem Jahr für Estland. Heute läßt sich kaum noch unterscheiden, was wirklich geschah, nach jenem Überraschungssieg im vergangenen Jahr, und was sich durch aufgeregtes Weitererzählen auf der Straße und in den Medien schon zum Mythos verklärt hat: Ist die Zustimmung der Esten zum Beitritt in die EU in der Woche nach dem Erfolg tatsächlich um zehn Prozent gestiegen? Hat ein Politiker den jubelnden Massen zugerufen: „Endlich haben wir Rußland besiegt?“ Glauben die Esten wirklich, daß sie drei schicksalhafte Aufgaben vor sich haben: den Beitritt in die EU und Nato und die Ausrichtung des Grand Prix?
Womöglich stimmt es sogar, daß der frühere Ministerpräsident Mart Laar in den Siebzigern die Show in Grand-Prix-Clubs im finnischen Fernsehen sah, als Fenster zur Welt und revolutionären Akt, weil das natürlich verboten war. Aber für die Masse der Menschen in Estland hatte der Song-Contest auch keine größere Bedeutung als bei uns. Die bekommt er erst jetzt. Die Regierung beteiligt sich mit mehreren Millionen Euro an den Kosten, weil sie weiß, daß so viel Aufmerksamkeit für ein kleines Land unbezahlbar ist, insbesondere für eines, das davon überzeugt ist, daß es ihm im Kern nur daran fehlt – an Aufmerksamkeit. Der Plan: Am 25. Mai werden mehr Menschen denn je auf Estland sehen, und sie werden sehen, daß es gut ist.
Man macht sich ja kein Bild. Hat allenfalls einen vagen Begriff von den „baltischen Staaten“, bei denen man weder die Reihenfolge kennt noch die Hauptstädte zuordnen kann. Das ist für die stolzen Esten besonders bitter, weil sie einerseits ein wenig gekränkt sind, daß die Eurovision Zweifel hatte, ob sie das Großereignis Grand Prix überhaupt ausrichten könnten, sich andererseits aber schütteln bei der Vorstellung, ein Land wie Litauen könnte einmal gewinnen, nicht auszudenken, das Chaos, man werde schon sehen. „Die Balten“ gibt es nicht, Esten sind introvertiert, diszipliniert, evangelisch, Litauer extrovertiert, chaotisch, katholisch, und wer das nicht schnell lernt, macht sich keine Freunde in Tallinn.
Es scheint, als hätte sich in den Jahren der russischen Unterdrückung ein riesiger Druck gebildet, der sich nach der Unabhängigkeit 1991 in Energie verwandelte. Als wollten sich die Esten mit Disziplin und Ehrgeiz in zehn Jahren nicht nur aus der Steinzeit in die Neuzeit katapultieren, sondern möglichst gleich in die erste Reihe der modernen Staaten. Sie haben eine Art papierlose Bürokratie entwickelt, bei der die Minister bei Kabinettssitzungen vor Laptops hocken und die Bevölkerung via Internet Zugang hat und sich freut, daß sich ihr Land auch „e-stonia“ schreiben läßt. Sie schicken sich an, Finnland den Ruf als Handy-besessenstes Land streitig zu machen, und bieten Autofahrern die Möglichkeit, Parktickets per Mobiltelefon zu bezahlen. Und sie haben überall blaue Schilder mit @-Zeichen aufgestellt, die den Weg zum nächsten Internet-Anschluß weisen – Verkehrszeichen, keine Reklameschilder. Sie stehen vor Cybercafés und Buchhandlungen. Auf dem Land warten sie am Straßenrand und weisen den Weg zu einem einsamen Haus, und wenn man klingelt, öffnet eine ältere Frau, führt einen in ein kleines Zimmer, schaltet den Computer ein, zeigt auf die Preisliste, die daneben liegt, und läßt einen surfen.
Das ist nicht ganz das, was man sich vorgestellt hatte. Wer nie dort war, schwankt auf der weiten Reise nach Norden und Osten, ob er sich Estland nun als einen Ableger des ultra-zivilisierten Skandinaviens vorstellen muß oder ein heruntergekommenes Stück Sowjetunion. Das Erstaunliche an Tallinn ist, daß es in mehreren Schichten all das verbirgt, was man sich vorstellt, und noch ein bißchen mehr. So kann man an einem kalten Winterabend (Frühling und Herbst fehlen zugunsten einer neunmonatigen Extended-Winter-Version) in Tallinn in wenigen Minuten eine Reise durch mindestens drei Welten antreten. Zwischen Flughafen und Innenstadt liegt gleich der Ostblock, beigegraue Häuser, breite Straßen in schlechtem Zustand, die von antik aussehenden Straßenbahnen gekreuzt werden. An den Haltestellen sitzen alte Mütterchen, Rußland ist nur ein paar Zugstunden entfernt.
Ein paar Schritte weiter rückt Rußland plötzlich ans andere Ende der Welt, dafür ist Lübeck ganz nah: Jenseits der Stadtmauer, von der heute noch mehr Wachtürme stehen, als man überhaupt je für nötig gehalten hätte, blättert sich die Altstadt als großes, pastellfarbenes Bilderbuch auf und erinnert an die Hansestadt Reval, die Tallinn einmal war: die meisten Häuser frisch herausgeputzt nach Jahren des Verfalls, Kopfsteinpflaster-Gassen und steile Stiegen, zum Glück in einem wilden Architektur-Mix aus den Jahrhunderten, was die Altstadt urig macht statt zuckersüß. Abends sind die Straßen bevölkert von finnischen Jugendlichen, die dem neuen Nachbarstaat ganz neue Freiheiten und preiswertes Bier verdanken, aber schon um zehn kaum noch stehen können.
Bis zum 1. Mai, der den Auftakt zum Sommer mit seinen „Weißen Nächten“ bildet, in denen die Sonne kaum untergeht und die Plätze voll sind mit Tischen und Bänken, sind die Straßen wenig später menschenleer. Gelbe Laternen tauchen die kalte Luft in ein unwirkliches Märchenlicht, das den Besucher völlig unvorbereitet läßt für die nächste Welt, nur eine Haustür entfernt: Im „Havanna Club“ tanzen sie Salsa, junge Paare drängen sich schwitzend auf einer Tanzfläche, ignorieren ausgelassen alle Klischees vom kühlen, verschlossenen Esten, und die gefrorene Märchenwelt für Touristen vor der Tür ist genauso unvorstellbar wie die Plattenbauten für die Russen ein paar Kilometer weiter.
In der „Nimega Bar“ erklärt einem der örtliche Vertreter der Adenauer-Stiftung, daß das Nachtleben sagenhaft wild sei, weil das Weggehen für die Esten, die ein paar Hundert Dollar im Monat verdienen, so teuer sei, daß es sich dann auch richtig lohnen müsse. Wie zum Beweis kommt gerade eine Bedienung vorbei, die nicht nur wie ihre Kolleginnen eine um beachtliche Mengen Stoff reduzierte braune Uniform trägt, sondern sich dazu klein „SS“ auf den nackten Rücken gemalt hat, was als Filzstiftzeichnung eher naiv denn politisch bedenklich wirkt und eine Menge aussagt über die merkwürdig ungespaltene Haltung der Esten gegenüber deutscher Geschichte. Selbst die SS ist hier, kurz gesagt, eher als Befreier von den Russen denn als Besatzer wahrgenommen worden.
Im halbprivaten Künstlerclub „Noku“ sitzen neben den Schauspielern junge Internet-Designer und Werbeleute, und wer Wert auf Geld und Stil legt, geht ins „Pegasus“, ein Restaurant in minimalistischem grauen Granit mit Philippe-Starck-Toilette, das genauso in Berlin-Mitte oder New York stehen könnte – und dort genauso cool wäre. Nur die Reiseführer haben dieses moderne Tallinn noch nicht entdeckt und staunen über den „Mut“, hier einen schwulen Club zu eröffnen, den „Nightman“, dabei empfiehlt den jeder aufgeklärte Hetero hier als angesagtesten Ort für den späteren Abend.
Anders gesagt: Tallinn ist bereit für den Grand Prix.



 Das ist eine eindrucksvolle Karte, die der
Das ist eine eindrucksvolle Karte, die der 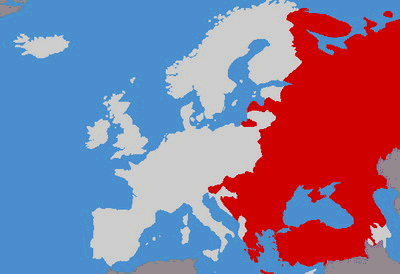
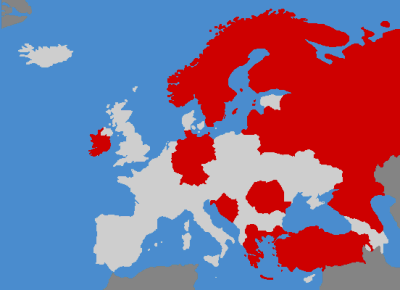
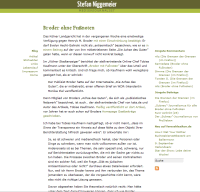 Ich habe
Ich habe  In Belgrad wird schon seit Tagen geprobt, in Deutschland ist die Jagdsaison für Käseigel eröffnet und zwischen Baltikum und Kaukasus macht man sich bereit, sich die Punkte schneller zuzuschanzen, als man
In Belgrad wird schon seit Tagen geprobt, in Deutschland ist die Jagdsaison für Käseigel eröffnet und zwischen Baltikum und Kaukasus macht man sich bereit, sich die Punkte schneller zuzuschanzen, als man