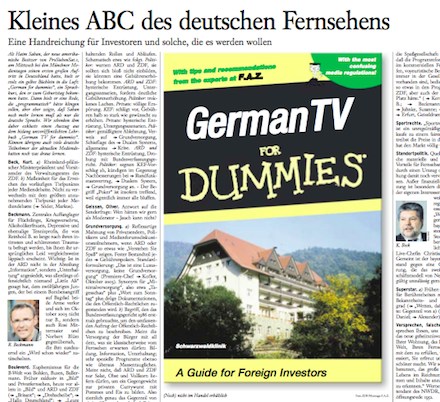Es ist nicht so schlecht, Mathias Döpfner zu sein. Er muss nur nach und nach, mit jeweils drei bis vier Jahrzehnten Verspätung, dezent andeuten, dass nicht alles so richtig koscher war, was der Verlag, dessen Vorstandsvorsitzender er heute ist, damals gemacht hat, um als Guter Mann von Axel Springer gefeiert zu werden.
Er muss sich dabei nicht einmal Mühe geben.
Am vergangenen Donnerstag meldeten die Nachrichtenagenturen: „Springer-Chef Döpfner bedauert ‚Bild‘-Vorgehen gegen Wallraff“. Das „Handelsblatt“ staunte:
Mathias Döpfner bricht ein Tabu. Der Chef des Medienkonzerns Axel Springer sucht die Aussöhnung mit dem Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff.
Der mutige Tabubrecher hatte sich in einem WDR-Film über die Methoden geäußert, mit denen sich Springer Ende der siebziger Jahre gegen Wallraffs Enthüllungen über „Bild“ gewehrt hatte. Der WDR verbreitete daraus vorab schon das Zitat Döpfners:
„Wenn damals Dinge in unserem Haus gelaufen sind, die sich mit unseren Vorstellungen, mit unseren Werten und im Rahmen unseres Handelns nicht vertragen — und so sieht das aus — dann wollen wir das wissen. Und wir sind gerade mitten dabei, das minutiös zu ergründen und aufzuklären. Und dann auch transparent zu machen. Wir haben nichts zu verstecken, weil, wenn damals Dinge falsch gelaufen sind, dann wollen wir sie heute zumindest wissen, um auch klar zu machen, so was tragen wir nicht mit.“
Das klingt merkwürdig verdruckst: die Kombination aus großer Aufklärerpose („minutiös aufklären“) mit dem Ziel eines zeit- und hilflosen potentiellen Aufstampfens („so was tragen wir nicht mit“).
Im Film geht die Szene mit Döpfner hier noch weiter. Der Autor fragt den Vorstandsvorsitzenden:
„Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen? Zum Beispiel das Abhören von Telefonaten?“
Die „Bild“ konnte damals nämlich offenbar — ermöglicht durch eine „untere Ebene des Bundesnachrichtendienstes“, wie Wallraff sagt — seine Telefongespräche in der Redaktion mithören. Döpfner aber schüttelt sofort den Kopf, als der Interviewer nach konkreten Beispielen fragt, blinzelt, blinzelt, blinzelt und winkt dann ab:
„Ich weiß zu wenig. Ich glaube, es gibt noch kein ganz konkretes und abgeschlossenes Bild, aber ich denke, das soll es so schnell wie möglich geben. Uns würde das jedenfalls sehr interessieren und da sollten alle mitwirken, die was wissen.“
Döpfner weiß zu wenig. Er ist wirklich wahnsinnig interessiert an dem, was damals passiert ist. Aber dann doch nicht interessiert genug, um sich einfach zu informieren.
1979 ist Wallraffs Buch „Zeugen der Anklage“ erschienen, eine Art Fortsetzung von „Der Aufmacher“ und in vieler Hinsicht eindrucksvoller, bedrückender, überzeugender als das Protokoll der Hans-Esser-Aktion. Darin findet sich ein Kapitel „Die Parallelschaltung“. Wallraff zitiert ausführlich aus Protokollen, die in der „Bild“-Redaktion von den mitgehörten und aufgezeichneten Telefongesprächen angefertigt wurden. Er veröffentlicht die eidesstattliche Erklärung eines „Bild“-Redakteurs, wonach er 1976 Zeuge wurde:
„wie in der Kölner BILD-Redaktion eine Abhörschaltung an den Privattelefonanschluß des Schriftstellers Günter Wallraff hergestellt wurde. Dabei wurden ein- und ausgehende Telefongespräche des Privatanschlusses von Herrn Wallraff über Tischlautsprecher mitgehört und auf Tonband aufgenommen. Dies geschah im Beisein von sechs Redakteuren und einem Fotografen.“
Wallraffs Buch ist voll sehr konkreter Vorwürfe und sehr konkreter Belege. Und Mathias Döpfner setzt sich zweiunddreißig Jahre später vor eine Fernsehkamera und tut, als wüsste man ja noch nichts über die Zeit damals, als sei das alles eine sehr verschwommene Geschichte, über die sich gerade erst der Nebel lichtet.
Jedem Politiker, jedem Wirtschaftsführer würde eine solche Wurstigkeit von Journalisten um die Ohren gehauen. Aber Döpfner zollt man Respekt für seinen „Tabubruch“, seine leeren Versöhnungsgesten?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Gratwanderung für Döpfner ist, mit der langen Verleugnungs- und Rache-Tradition seines Verlages zu brechen. Doch seine Äußerungen im WDR-Film sind unredlich. Er sagt etwa:
„‚Bild‘ war in den sechziger und in den siebziger Jahren so etwas wie der Lieblingsfeind eines linksliberalen intellektuellen Millieus. Und insofern war es sicherlich ein sehr begehrliches Ziel. Und ein journalistisch interessanter Stoff, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist ja sicher so, dass ‚Bild‘ aus heutiger Sicht damals nicht alles richtig gemacht hat und Fehler gemacht hat, und insofern, rein unter journalistischen Gesichtspunkten kann ich [Wallraffs Vorgehen] gut nachvollziehen.“
Nein. Nein.
„Bild“ hat nicht nur „aus heutiger Sicht“ damals Fehler gemacht. Es hätte auch damals schon jedem Beteiligten klar sein müssen, dass die „Bild“-Methoden unzulässig waren. Das ist nichts, wie Döpfner suggeriert, das man erst mit irgendeinem Fortschritt in der Evolution der journalistischen Ethik in den vergangenen drei, fünf, elf Jahren erkennen konnte. Es war erkennbar falsch.
Und es ist auch nicht so, wie Döpfner suggeriert, dass „Bild“ bloß aus ideologischen Gründen von den Linken angegriffen wurde, etwa, weil „Bild“ sich gegen jeden gesellschaftlichen Fortschritt stemmte. „Bild“ war nicht deshalb ein legitimes Ziel für Wallraffs Undercover-Aktion, weil „Bild“ konservative Politik machte. Sondern weil „Bild“ log, manipulierte, Leben zerstörte.
Aus Döpfners Sätzen spricht kein Aufklärer. Sondern jemand, der hinter aufklärerischer Fassade weiter Geschichtsklitterung betreiben will, nur in zeitgemäßerer, erfolgversprechenderer Form.
Döpfner weiter:
„Da ist sicherlich auf Seiten des Axel Springer Verlages einiges falsch gemacht worden. Man hat sich durch diese Rolle als Lieblingsfeind der Achtundsechziger einfach zu sehr in eine Bunkermentalität geflüchtet und hat Positionen verhärtet und verschärft und sich damit auch selbst geschadet. Auf der anderen Seite glaube ich, dass natürlich viele Klischees, die sich damals gebildet haben, Anti-Springer-Klischees, Anti-‚Bild‘-Klischees, vermutlich schon damals nicht richtig waren und auch damals nicht fair waren.“
Auf subtile Weise rückt Döpfner, während er vorgeblich das Verhalten von Zeitung und Verlag damals kritisiert, die „Bild“-Zeitung mindestens teilweise in eine Opferrolle. Ein Opfer, dem von den Achtundsechzigern in einer Weise zugesetzt wurde, dass es sich falsch gewehrt hat.
Dann relativiert er gleich wieder, auf seine unnachahmliche über den Dingen schwebende Art: „Bild“ und Springer hätten teilweise unrecht gehabt, aber die Kritik an „Bild“ und Springer sei auch ungerecht gewesen.
Man dürfte hier jetzt vermutlich wieder nicht nachfragen, ob er dafür mal ein konkretes Beispiel für ein ungerechtes Anti-„Bild“-Klischee nennen könnte, und welche der vielen nicht nur und nicht erst von Wallraff belegten Manipulationen durch „Bild“ einer Überprüfung nicht standhalten. Vermutlich gibt es auch da „noch kein ganz konkretes und abgeschlossenes Bild“.
Natürlich ist es begrüßenswert, wenn Springer jetzt tatsächlich die Vorgänge rund um Wallraffs Enthüllungen aufarbeiten will. Aber wäre es vom Vorstandsvorsitzenden wirklich zuviel verlangt, sich zumindest auf den Stand von 1979 zu bringen, bevor er öffentlich den Aufklärer gibt?
Und die Formulierung „uns würde das jedenfalls sehr interessieren und da sollten alle mitwirken, die was wissen“ klingt für mich frappierend nach der Haltung, die Springer bei späten Dokumentation der unrühmlichen Verlagsgeschichte um 1968 entwickelte. Aus der spät erkannten Notwendigkeit, die eigene Geschichte kritisch zu erforschen, wurde ein Vorwurf an die Kritiker, sich der Debatte zu verweigern — weil die nicht nach Springers historischem Zeitplan und unter Springers Bedingungen diskutieren wollten.
Aber immerhin: Springer ist bei der Auseinandersetzung mit den eigenen Fehlern und Versäumnissen jetzt schon in den siebziger Jahren angekommen. Womöglich dauert es jetzt nur noch zwanzig, dreißig Jahre, bis der Vorstandsvorsitzende sich auch öffentlichkeitswirksam selbstkritisch Gedanken macht, wie „Bild“ in den vergangenen zehn Jahren gelogen, manipuliert, Menschenleben zerstört und ein ganzes Volk wie die Griechen verhetzt hat.
Aber vielleicht weiß man dazu ja einfach noch zu wenig.