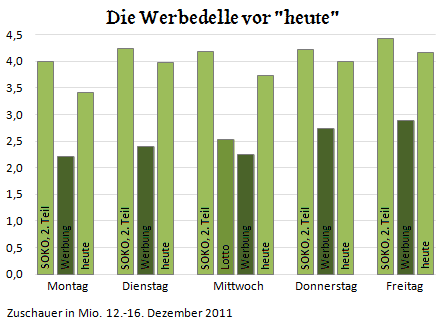Ich frage mich, ob man als „Bild“-Zeitung-Macher manchmal darunter leidet, dass man es zu leicht hat. Man kann heute alle Register eines unseriösen Schmuddelblattes ziehen, und sich morgen wieder als seriöse Zeitung geben. Man hat die Wahl, Dinge zu veröffentlichen, Dinge nicht zu veröffentlichen und Dinge zu veröffentlichen, ohne sie zu veröffentlichen. Man kann es mit der Wahrheit ganz genau nehmen oder schon das Konzept „Wahrheit“ an sich als eine Erfindung von Korinthenkackern abtun. Man muss niemandem Rechenschaft ablegen oder tut es einfach nicht. Und keine Sekunde muss man sich um sein dummes Geschwätz von gestern kümmern.
· · ·
Fangen wir der Einfachheit halber ganz hinten an: Beim Auftritt von Nikolaus Blome bei Günther Jauch gestern abend. Blome ist der stellvertretende Chefredakteur der „Bild“-Zeitung. Sein Dackelblick ist in den vergangenen Monaten so etwas wie das menschliche Antlitz von „Bild“ in der Öffentlichkeit geworden.
Auch bei Jauch hatte er es leicht. Niemand wollte so recht die Rolle der „Bild“-Zeitung in dem Spektakel der letzten Wochen thematisieren; es ging um Wulff.
Immerhin stellte jemand eine berechtigte Frage: Warum es zwei Wochen gedauert hat, bis Wulffs angebliche Droh-Nachricht auf der Mailbox von „Bild“-Chef Kai Diekmann an die Öffentlichkeit kam.
Blome hatte einen originellen Erklärungsversuch: Er vermutet, dass der Auslöser die Kritik von Bundestagspräsident Norbert Lammert gewesen sei, der es an Silvester gewagt hatte zu sagen: „Auch die Medien haben Anlass zu selbstkritischer Betrachtung ihrer offensichtlich nicht nur an Aufklärung interessierten Berichterstattung.“ Daraufhin, so Blomes These, hätten die sich zu Unrecht angegriffen fühlenden Journalisten die Mailbox-Sache in die Öffentlichkeit gebracht.
Außerdem, fügte er hinzu, sei die Geschichte mit der Nachricht auf der Mailbox ja erst richtig groß geworden, nachdem Wulff selbst in seinem Interview in ARD und ZDF darüber geredet und ihren Inhalt — Blomes Ansicht nach — falsch dargestellt habe, nämlich als bloßen Versuch, einen Tag Aufschub herauszuhandeln.
Ich glaube, dass es einen Menschen auf Dauer deformiert, wenn er so etwas sagen kann, ohne dass er schallendes Gelächter erntet oder ihm jemand sachte die Hand auf den Arm legt und sagt: „Herr Blome? Der Bundespräsident musste das Interview überhaupt nur geben, weil der öffentliche Druck so groß geworden war, nachdem die Sache mit der Mailbox an die Öffentlichkeit gekommen war.“
· · ·
Was für eine bizarre Situation: In der ARD-Talkshow zitiert Jauch, was der „Spiegel“ unter Berufung auf Springer über Wulffs Anrufe bei Diekmann und Vorstandschef Mathias Döpfner schreibt, und fragt Blome, ob das richtig sei. Was der „Spiegel“ schreibt. Was er von Springer weiß. Und Blome bestätigt es.
Die „Bild“-Zeitung fragt öffentlich beim Bundespräsidenten an, ob sie den Wortlaut seiner Mailbox-Nachricht veröffentlichen darf. Als er Nein sagt, verzichtet sie, ganz das hyperseriöse Blatt, auf eine Veröffentlichung.
Zu diesem Zeitpunkt haben Springer-Leute anderen Journalisten ausführlich aus der Abschrift der Nachricht am Telefon vorgelesen — unter der Maßgabe, nicht vollständig mitzuschreiben und das Gespräch nicht aufzuzeichnen.
Die „Bild“-Zeitung feuert die Munition, die ihr der Bundespräsident in seiner Dummheit geliefert hat, nicht selbst ab. Sie reicht sie an andere weiter. Sie kann nach dem großen Knall ihre Hände vorzeigen: keine Schmauchspuren.
Sie muss sich keinen Fragen stellen, ob es womöglich ein Vertrauensbruch war, Details aus der Nachricht zu veröffentlichen, wenn Diekmann doch gegenüber Wulff die Sache nach einer Entschuldigung als erledigt bezeichnet hatte. Sie hat sie ja nicht veröffentlicht. Außer doch.
· · ·
Letztens hat mich ein Kollege gefragt, wer eigentlich der Böse in der Geschichte sei, „Bild“ oder Wulff. Das ist die falsche Frage und in Wahrheit gar keine Alternative. Klar ist, wer der Depp ist und wer der klug Handelnde.
· · ·
Ich verstehe den Frust darüber, in welchem Maße sich die Berichterstattung auf den Bundespräsidenten konzentriert und wie wenig sie sich um die Rolle von „Bild“ kümmert. Es gibt dafür aber immerhin einen guten Grund: Es geht auf der einen Seite um die Ansprüche an das deutsche Staatsoberhaupt und auf der anderen Seite nur um die an eine Boulevardzeitung.
Anders gesagt: Wir haben in den vergangenen Wochen einiges Neues über den Charakter von Christian Wulff gelernt. Und nichts Neues über den Charakter der „Bild“-Zeitung.
Natürlich kann man sich, wenn man will, darüber empören, dass das, was man Kai Diekmann auf die Mailbox spricht, nicht vertraulich bleibt. Oder, alternativ, dass Diekmann nicht die Eier hat, die Grenzüberschreitung selbst öffentlich zu machen und mit offenem Visier zu kämpfen. Aber hat irgendjemand etwas anderes von Kai Diekmann erwartet?
Es mag allerdings sein, dass Wulff Grund zur Annahme hatte, er könne sich diese Art der Einflussnahme erlauben. Vielleicht hat das früher geklappt, Freundschaftsdienste auf diese Weise einzufordern. Auch das dürfte — angesichts der Art, wie „Bild“ für Wulff PR gemacht hat und wie sehr Wulff der „Bild“ Exklusiv-Geschichten geschenkt hat — niemanden wundern.
· · ·
Erinnert sich noch jemand an das Jahr 2004, als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Pressefreiheit in Deutschland abschaffte? Durch das sogenannte „Caroline-Urteil“ wurde das Recht eingeschränkt, über Privates aus dem Leben von Prominenten zu berichten, wenn es keinem anderen Interesse dient als der Sensation oder Unterhaltung. Siebzig Chefredakteure riefen damals in einem offenen Brief „Zensur!“, weil die „wichtigste Aufgabe der freien Presse, den Mächtigen auf die Finger zu schauen, massiv behindert“ werde. Es unterschrieben in einem der traurigsten Akte fehlgeleiteter journalistischer Solidariät unter anderem die Chefredakteure von „Spiegel“, „Stern“, „Playboy“, „Das neue Blatt“, „Neue Post“, „Das Haus“ und natürlich „Bild“ und „Bild am Sonntag“.
„Bild“ beließ es nicht dabei. Öffentlichkeitswirksam kündigte Kai Diekmann damals an, Konsequenzen aus dem Urteil zu ziehen und bis auf weiteres auf Homestories über Politiker zu verzichten. Nach dem „Maulkorburteil“ sei unklar, was an kritischer Berichterstattung noch erlaubt sei. „Deshalb müssen wir umgekehrt beim Leser jetzt von vornherein jeden Anschein vermeiden, wir würden mit eingebauter Schere im Kopf nur noch Hofberichterstattung betreiben.“
Das war damals schon lächerlich. Und keine zwei Jahre später begann in „Bild“ der große (inzwischen abgeschlossene) Liebesroman „Christian Wulff und sein perfektes Privatleben“, mit Berichten über neue Wohnungen, neue Frisuren, neue Kinder, neues Glück.
Natürlich hatte „Bild“ dabei die Schere im Kopf. Es war die ganz eigene Schere der kalkulierten Hofberichterstattung über Menschen, die sich auf das Spiel von „Bild“ einlassen und ihr den Stoff geben, den sie begehrt.
· · ·
Als Nikolaus Blome von Günther Jauch gefragt wurde, ob man an der Berichterstattung über Wulff — erst rosarot verklärt, dann gnadenlos vernichtend — das berüchtigte Aufzugs-Prinzip von „Bild“ erkennen könnte, antwortete der „Bild“-Mann erst mit einer witzig gemeinten Bemerkung darüber, dass es in der Axel-Springer-Zentrale in Berlin einen Paternoster gebe. Dann fand er es abwegig, und meinte das offenbar leider nicht mehr als Witz, dass man „Bild“ vorwerfe, aus der „eher glimpflichen Scheidung“ der Wulffs „keine Schlammschlacht“ gemacht zu haben. Und schließlich sagte er noch, dass einige der PR-Schlagzeilen, die „Bild“ Wulff in den Zeiten bester Zusammenarbeit schenkte und die Jauch gezeigt hatte, bloß aus den Regionalausgaben von „Bild“ stammten. Blome sagte die Unwahrheit. Jede der gezeigten Geschichten war in der Bundesausgabe.
· · ·
Es ist schon richtig, dass an einen Bundespräsidenten andere Ansprüche an Ehrlichkeit zu stellen sind als an den stellvertretenden Chefredakteur einer Boulevardzeitung. Das bedeutet aber nicht, dass man ihm und seinem Blatt jede Lüge, jeden schmierigen Trick, jede irrwitzige Pose einfach durchgehen lassen muss.
Ein chronischer Lügner und Trickser beschuldigt jemanden, zu lügen und zu tricksen. Das ist selbst dann ekelhaft, wenn der Vorwurf — wie offenbar in diesem Fall — stimmt. Deshalb hat die langjährige Freundin von Wulff Recht, wenn sie bei Jauch rührend hilflos fomuliert, sie möchte in keinem Land leben, in dem die „Bild“-Zeitung bestimmt, was Moral und was richtig ist.
Und deshalb ist der Eindruck so verheerend, dass andere Medien sich von „Bild“ haben einspannen lassen, der „Bild“-Geschichte an den entscheidenden Stellen die eigene Seriösität leihen und Seite an Seite mit „Bild“ kämpfen.
„Es gab keinen Bruch“ in der Beziehung zwischen „Bild“ und Wulff, heuchelte Blome. Das ist sowohl angesichts der real existierenden Berichterstattung von „Bild“ als auch angesichts von Wulffs Nachricht auf der Mailbox offenkundig unwahr. Blome meint natürlich, dass es nie eine innige Beziehung zu Wulff zum beiderseitigem Vorteil gegeben habe.
Das Problem ist, dass bis heute unklar ist, was den Bruch ausgelöst hat. Es könnte einen konkreten Anlass gegeben haben; vielleicht war es auch bloß die Abwägung von „Bild“, dass sich inzwischen ein exklusiver Zugang zu Wulff samt schöner Geschichten weniger lohnt als die Möglichkeit, sich an die Spitze seiner Kritiker zu setzen.
Das ist eine größere Leerstelle in der Geschichte und sie korrespondiert mit vielen kleinen Leerstellen, die der Springer-Verlag gelassen hat. Eine Woche lang musste sich die Nation ein Urteil über eine Nachricht von Christian Wulff erlauben, das allein auf einzelnen kurzen Satzfetzen beruhte, die der Springer-Verlag lanciert oder freigegeben hat. Offenbar hat bis jetzt noch niemand außerhalb des Springer-Verlages die Nachricht selbst gehört. Quelle ist allein eine Abschrift des Telefonates.
Dadurch, dass „Bild“ das Gespräch nicht vollständig veröffentlicht hat, schützte das Blatt nicht Wulff, sondern maximierte den Schaden, weil es die Veröffentlichung weitgehend steuern und die Interpretation beeinflussen konnte. (Dass der Bundespräsident dann die geschickt später nachgeschobene Bitte von „Bild“, die Nachricht nun auch offiziell veröffentlichen zu dürfen, ablehnte, spricht natürlich wieder für seine umfassende Ungeschicklichkeit und Dummheit in dieser Sache.)
· · ·
Ein Schlüsselmoment in der Affäre ist, als der später entlassene Wulff-Sprecher Olaf Glaeseker den „Bild“-Reporter Martin Heidemanns am 6. Dezember ins Schloss Bellevue bittet. Er will die Gerüchte ausräumen, dass der zwielichtige Unternehmer Carsten Maschmeyer hinter dem Kredit für sein Haus steckt, und deshalb „Bild“ verraten, von wem das Geld wirklich stammt.
Das Dokument, mit dem „Bild“ von der Verbindung zu den Geerkens erfuhr und die Frage aufwerfen konnte, ob Wulff das niedersächsische Parlament 2010 belogen hat, bekam das Blatt also vom Präsidentensprecher selbst. Strittig ist, unter welchen Voraussetzungen: Wulff sagt, Heidemanns habe versprochen, den Namen des Kreditgebers nicht zu nennen. Das erklärt vermutlich auch seinen Zorn und seine Drohung mit strafrechtlichen Schritten. Heidemanns sagt, er habe vor Ort diese Forderung ausdrücklich abgelehnt, und Glaesekers habe ihm das Dokument dann trotzdem gezeigt.
Ich weiß natürlich nicht, wer die Wahrheit sagt. Aber ich weiß, wer Martin Heidemanns ist. Er ist bei Menschen, die mit ihm zu tun haben mussten, ein besonders verhasster „Bild“-Mann. Seine Drohungen und auf die Betroffenen erpresserisch wirkenden Methoden sind berüchtigt.
Und auf diesen Mann glaubt der Bundespräsident seine Entlastungsstrategie aufbauen zu können? Ihm lässt er die entscheidenden Dokumente zeigen? Ich weiß nicht, ob Heidemanns Stillschweigen versprochen hat oder nicht. Es ist aber auch vollständig egal, da man schon außerordentlich blauäugig sein muss, um ihm zu trauen.
· · ·
Christian Wulff ist, das zeigt auch dieses Detail, nicht darüber gestolpert, dass er sich mit „Bild“ angelegt hat, sondern darüber, dass er immer noch glaubte, mit ihr gemeinsame Sache machen zu können.
Das ist eine wichtige Erkenntnis, denn das wäre eine verheerende Lehre, die Prominente und Politiker aus der ganzen Geschichte ziehen könnten: Dass es so tödlich ist, wie man immer schon angenommen hat, sich mit „Bild“ anzulegen. Nein, tödlich ist es, zu glauben, einen Pakt mit der „Bild“-Zeitung schließen zu können und davon am Ende profitieren zu können. Im Zweifel wird nur einer von beiden von einem solchen Pakt profitieren, und das ist derjenige, der es sich erlauben kann zu tricksen und zu lügen, heute mit Schlamm zu werfen und morgen seriös zu tun, keine Rechenschaft ablegen zu müssen und sich keine Sekunde um sein Geschwätz von gestern kümmern zu müssen.
· · ·
Leseempfehlungen: