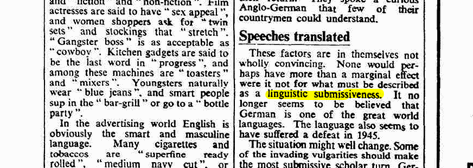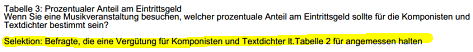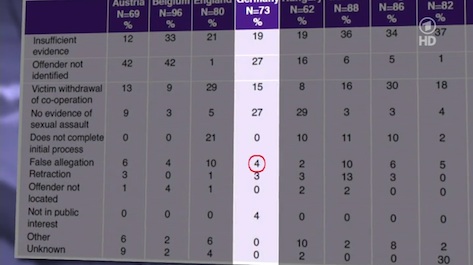Halloween nervt. Aber nichts nervt an Halloween so sehr wie Walter Krämer.
Diese lächerlichen Rituale. Dieses Zombietum. Sie passen gut zueinander, das amerikanische Fest und der Vorsitzende des Vereins Deutsche Sprache VDS.
Halloween ist eines der wichtigsten Feste für den VDS. Es ist der Tag, an dem er an die Türen der Menschen klopft und fordert, dass man tut, was er sagt, und von den Medien dafür mit kostbarer Aufmerksamkeit beschenkt wird.
Es droht nichts weniger als der Untergang der deutschen Kultur und Sprache.
Der Dortmunder Verein Deutsche Sprache e.V. protestiert gegen die republikweite Übernahme des amerikanischen Kinderfestes Halloween. „Wir haben nichts gegen fremde Feste und Kulturen,“ erklärte der Vereinsvorsitzende Krämer gegenüber dpa. „Aber die gegenwärtige Amerikanisierung unserer eigenen Kultur geht uns zu weit.“
(2003)
„Jedes Land pflegt seine eigenen Bräuche und seine eigene Kultur“, so der VDS-Vorsitzende Prof. Walter Krämer gegenüber dpa. „Wir in Deutschland brauchen diesen amerikanischen Kürbisfasching nicht.“
(2006)
„Warum äffen wir gedankenlos die Amerikaner nach?“, fragt der VDS-Vorsitzende, Walter Krämer.(…) Bundesbürger, an deren Haustüren am 31. Oktober Kinder um Geschenke bitten, sollten an die christliche Tradition des Martinssingens am 10. und 11. November erinnern, so Krämer.
(2008)
Der US-Import Halloween hat nach Ansicht des Vereins Deutsche Sprache (VDS) in Deutschland nichts zu suchen. Der „inhaltsleere Geisterkult“ sei eine „Frontalattacke gegen deutsche Sprache und Kultur“. „Natürlich wissen wir, dass diese Sitte aus dem keltischen Europa kommt. Aber noch näher steht uns unsere eigene Kultur, die etwa mit dem Reformationstag verbunden ist“, sagte der Vorsitzende Walter Krämer laut einer Mitteilung am Dienstag in Dortmund.
(2012)
Die diesjährige Reinkarnation des Genöles ist besonders schön. Darin doziert Krämer nicht nur, dass in dieser Jahreszeit gefälligst Besinnung zu herrschen habe und für „ausgehöhlte Kürbisse“ darin kein Platz sei. Er fügt auch, scheinbar hilfreich, hinzu:
„Und wer gerne mit Kindern und Laternen durch die Straßen zieht, kann das am hergebrachten St. Martinstag genauso tun.“
Ich mag mich täuschen — ich bin ja, wie Krämer, kein Experte für deutsche Sprache. Aber nach meinem Verständnis bedeutet sein Satz, dass die Kinder es eben auch „genauso“ am Halloween-Fest tun können. Jeder wie er mag. Ein freies Land.
Das hat Krämer sicher nicht gemeint. Er und sein Verein sind Kämpfer gegen die Freiheit. Die Leute sollen gefälligst Reformationstag feiern, ob sie nun evangelisch sind oder nicht.
Und sie sollen gefälligst so reden, wie es dem VDS gefällt. Sogar die — vermeintlich — falsche Aussprache von Landesnamen vom anderen Ende der Welt wird vom Verein abgemahnt.
Und die Medien berichten sogar darüber und stellen Krämer Fragen wie:
Ihr Verein hat bundesweit 16 000 Mitglieder, eine erstaunlich hohe Zahl. Was tun die Mitglieder, um die Ziele praktisch durchzusetzen?
Und Krämer gibt Antworten wie:
Ganz einfach: Die deutsche Sprache benutzen und diejenigen, die durch extreme Sprachilloyalität auffallen, auf diese peinliche Illoyalität hinweisen. Denn im Ausland wird dieses Anbiedern an andere genau als das empfunden, was es ist: eine peinliche Missachtung der eigenen Heimat und Kultur. Die Londoner „Times“ hat das einmal typisch deutsche „linguistic submissivness“ genannt.
Das ist auf so vielen Ebenen verkorkst, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Vielleicht beim falsch geschriebenen Wort „submissiveness“. Krämer meint, dass europäische Kinder in der Schule als erste Fremdsprache nicht Englisch lernen sollen, denn das würden sie im Laufe ihrer Ausbildung ohnehin lernen. Q.e.d., nehme ich an.
Kann natürlich auch sein, dass der „Tagesspiegel“ das verbockt hat. Denn Krämer müsste eigentlich wissen, wie sich „linguistic submissiveness“ schreibt, weil er und sein Verein nicht müde werden, den Begriff zu benutzen, als habe er eine Relevanz.
Er stand tatsächlich in der „Times“. Einmal, in einer kruden Glosse ihres Deutschland-Korrespondenten, erschienen am 16. Juni 1960:

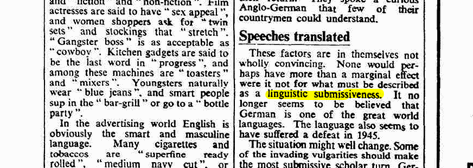
So genau erwähnt Krämer das auf seiner seit vielen Jahren andauernden Medientournee mit dem Schlager „Weg mit dem Denglisch“ aber lieber nicht. (Dass der „Times“-Korrespondent den vermeintlichen sprachlichen Minderwertigkeitskomplex „peinlich“ fand, wie Krämer behauptet, ergibt sich auch nicht aus seinem Artikel. Er meint stattdessen, die Niederlage der Deutschen 1945 könnte auch eine Niederlage des Deutschen gewesen sein.)
Und wenn es tatsächlich typisch deutsch sein sollte, Wörter aus anderen Sprachen mit übertriebener Offenherzigkeit zu übernehmen — warum müssen wir das bekämpfen, und dann auch noch im Namen der Verteidigung des typisch Deutschen? Logisch ist das nicht.
Das Tollste an Krämers Argumentation ist, wie sie sich in den Schwanz beißt. Er meint, wir sollten uns nicht an das Ausland anbiedern, weil das im Ausland gar nicht ankomme. Mit anderen Worten: Wir sollten uns dem Ausland dadurch anbiedern, dass wir uns nicht anbiedern.
Dass die Frage, was Leute aus einem anderen Sprachraum über unseren Sprachgebrauch denken, einfach gar keine Rolle spielen könnte, weder im Sinne einer bewussten Übernahme von fremden Wörtern noch den bewussten Verzicht, darauf kommt Krämer nicht. Undenkbar für ihn, dass die Deutschen alberne Wörter wie „Handy“ möglicherweise nicht deshalb benutzen, weil sie den Amerikanern gefallen könnten, sondern weil sie ihnen selbst gefallen.
Aber wenn man das annähme, käme man womöglich auch auf den Gedanken, dass die Fragen, um die sich der VDS mit soviel Wucht, Redundanz, Todessehnsucht und Unkenntnis kümmert, eher Fragen des Geschmacks sind.
Aber der sympathische Krämer verdankt seinen groebelhaften Aufstieg in den Medien natürlich nicht der Rolle eines Meinungshabers und Geschmacksjuroren, sondern seinem zugeschriebenen Expertenstatus.
Es ist nicht ganz klar, was den Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund dafür qualifiziert. Schlimmer noch: Der Expertenstatus von Leuten wie Krämer in den Medien wird auch durch erwiesene Unzuverlässigkeit nicht bedroht — es gibt (neben der „Times“-Sache) genug Anlässe, ihn in Sprachfragen eher als Scharlatan zu behandeln.
Und nicht nur da.
Die Kollegen von „Spiegel Online“ zum Beispiel haben gerade die unangenehme Erfahrung gemacht, was passiert, wenn man sich auf Krämer verlässt und deshalb einen ganzen Artikel lang vom „Durchschnitt“ spricht, wenn eigentlich der „mittlere Wert“ gemeint ist, was nicht dasselbe ist (vgl. Berichtigung hier).
Aus irgendeinem Grund hat DRadio Wissen Krämer jetzt das Mikro hingehalten und einen Beitrag über „Panikmache in deutschen Medien“ gesendet, der ausschließlich auf seinen Aussagen und seinem im vergangenen Jahr erschienenen Buch „Die Angst der Woche“ beruht.
Seine These, dass die Medien uns Angst machen, wo die Risiken in Wahrheit klein sind, und das, was uns wirklich beunruhigen soll, dagegen zu kurz kommt, ist sicher richtig. Aber auf seine Beispiele sollte man sich lieber nicht verlassen.
DRadio Wissen erzählt ein Beispiel Krämers nach:
Viele Zeitungen titelten im März 2012, dass der Farbstoff in Cola und Pepsi krebserregend sei. Allerdings müsste man täglich etwa 1000 Dosen Cola trinken, um sich der Gefahr auszusetzen.
Ja. Und genau so stand das auch in den Medien, die darüber berichteten.
Oder die Sache mit dem Föhn-Test, eine Lieblingsgeschichte, die Krämer gern erzählt. DRadio Wissen beschreibt sie so:
Es gab einmal Schlagzeilen über Haartrockner, die bei einem Test plötzlich Feuer fingen. Walter Krämers genauere Recherche ergab: Es war lediglich ein Haartrockner und der entflammte erst nach 70 Stunden Dauerbetrieb.
Beim unmittelbaren Aufeinanderfolgen der Wörter „Walter Krämer“ und „genauere Recherche“ sollte man stutzig werden.
In diesem Fall hat Krämer gar nicht recherchiert.
Er bezieht sich auf einen Artikel in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“:
„Gerade mal drei Sekunden föhnte eine Testperson beim Vergleich von 16 Haartrocknern ihre Haare mit dem Elta Germany HAT 352, als dieser mit einem lauten Knall durchschmorte.“ Da hat sich die Testperson sicher sehr erschrocken. „Auch im Dauertest brannte das 10-Euro-Gerät nach 72 Stunden lichterloh, vom Gehäuse blieb nichts übrig.“ Da kann ich nur sagen: Danke, liebe „Hannoversche Allgemeine Zeitung“, dass ihr mir so deutlich zeigt, was alles passieren kann, wenn man einen Föhn 72 Stunden lang ununterbrochen laufen lässt. Das mache ich schließlich fast gewohnheitsmäßig.
Ja, so lustig ironisch ist der Walter Krämer.
Hätte er aber genauer recherchiert (hier in der Bedeutung von „einmal kurz gegoogelt“), hätte er gewusst, dass sich die Testperson keineswegs bloß erschrocken hat. Nach Angaben der Stiftung Warentest drang aus dem Gerät „eine 20 Zentimeter lange Stichflamme“, im Bad fiel der Strom aus, und es roch nach verbranntem Haar und Kunststoff.
Sicher, das ist nichts im Vergleich zu den Gefahren eines Atomkrieges, könnte einem aber doch den Tag versauen und bei der Wahl des Haartrockners ein nicht unwesentliches Argument sein.
Und was den 72-Stunden-Dauerbetrieb angeht: Der bestand nicht, wie Krämer uns glauben machen will, aus ununterbrochenem 72-Stunden-Dauergeföhne. Wie im Testbericht angegeben, wurden die Geräte abwechselnd 15 Minuten lang auf volle Stufe gestellt und durften dann 15 Minuten lang ausruhen.
Das entspricht aber natürlich auch nicht dem Alltag im Hause Krämer. Da hört die Produktion heißer Luft eigentlich nie auf.
Happy Halloween!