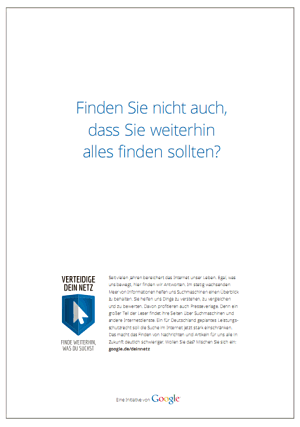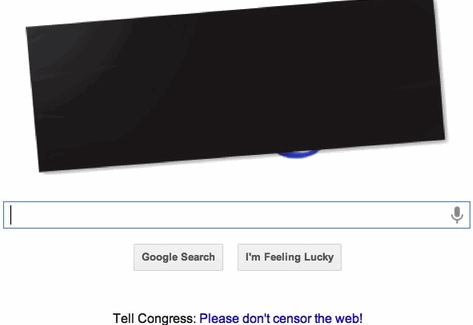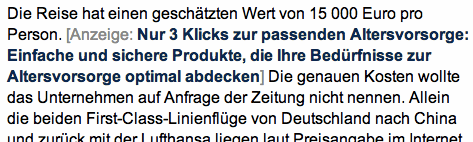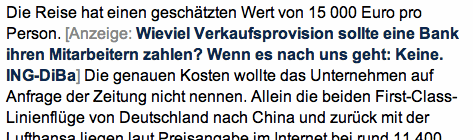Die Präsidenten der deutschen Verlegerverbände haben einen gemeinsamen Brief an die Bundestagsabgeordneten geschickt. Sie beklagen sich darin über die angeblich „irreführenden Aussagen und unbegründeten Behauptungen“, mit denen der Suchmaschinenanbieter Google Stimmung gegen das Leistungsschutzrecht macht. Sie schreiben:
Jeder sollte wissen, Google ist noch zu viel mehr im Stande – ohne sich wie die deutsche Presse der Wahrheit verpflichtet zu fühlen.
Die zweite Hälfte dieses Satzes ist erstaunlich. Die erste aber auch. Was wollen Hubert Burda und Helmut Heinen mit diesem Geraune andeuten? Wovor sollen wir Angst und Panik haben?
Der Text, der gleichzeitig beklagt, dass Google „perfide mit Angst und Panik arbeite“, lässt das bezeichnenderweise offen. Aber einen Hinweis, was gemeint sein könnte, liefert heute das „Handelsblatt“. Es schreibt:
Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) hatte wegen der Onlinekampagne von Google indirekt zum Boykott des Suchmaschinenbetreibers aufgerufen: „Es gibt noch andere Suchanbieter als Google“, sagte sie dem Handelsblatt.
Google hat offenbar darauf auf seine Weise reagiert. Auffällig war, dass gestern über Stunden die aktuelle Debatte über das Leistungsschutzrecht und den Boykottaufruf gegen Google der Justizministerin über eine Google-Suche nicht zu finden war. Bei Yahoo hingegen gab es bei gleichen Stichworten sofort Treffer zur aktuellen Debatte. Manch einer im Justizministerium sprach darum gestern von „Zensur“.
Darin steckt ein ungeheurer Vorwurf: Google soll Nachrichten, die dem Unternehmen nicht genehm sind, verschwinden lassen. Das wäre in höchstem Maße alarmierend. Falls das „Handelsblatt“ diesen Verdacht belegen können sollte, wäre es erstaunlich, ihn nur eher unauffällig am Ende eines Textes zu bringen, der die unscheinbare Überschrift „RTL fordert klares Bekenntnis zum Urheberrecht“ trägt.
Ein Google-Sprecher wies die „Handelsblatt“-Behauptung auf meine Anfrage zurück: „Ein solcher Vorwurf ist durch nichts begründet und absurd.“
Aber dann reden wir doch mal über „Zensur“. Oder genauer: über das Verschwindenlassen missliebiger Informationen.
Am Dienstagnachmittag hat der geschäftsführende Direktor des Max-Planck-Institutes für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht eine Pressemitteilung verschickt. Sein Institut, die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) sowie mehrere weitere Wissenschaftler üben in einer Stellungnahme vernichtende Kritik an dem Gesetzentwurf, der heute Nacht in erster Lesung im Bundestag beraten werden soll.
Die führenden deutschen Zeitungen haben ihren Lesern die Existenz dieser Kritik namhafter Fachleute an dem geplanten Gesetz bis heute verschwiegen.
Es ist unwahrscheinlich, dass sie ihnen nicht bekannt ist. Die Nachrichtenagentur dpa hat erstmals gestern Vormittag in einer Meldung darüber berichtet („Wissenschaftler: Leistungsschutzrecht ’nicht durchdacht'“). In mindestens vier weiteren dpa-Meldungen ist die Stellungnahme erwähnt.
Trotzdem steht kein Wort davon in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, in der „Süddeutschen Zeitung“, in der „Welt“, im „Handelsblatt“ — alles Blätter, deren Verlage für ein Leistungsschutzrecht kämpfen und deren Redakteure gestern und heute teilweise wuchtigst Google für seine vermeintliche Desinformation kritisiert haben.
Es scheint nicht nur eine Platzfrage gewesen zu sein. Auch auf den Online-Seiten der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, der „Süddeutschen Zeitung“ und der „Welt“ ist nichts von der Kritik zu lesen. (Nachtrag: Ausnahme sind die automatischen Newsticker, die automatisch alle dpa-Meldungen übernehmen.) Immerhin bildet das „Handelsblatt“ hier eine überraschende positive Ausnahme; auch „Spiegel Online“ hat über die Kritik berichtet.
Aber in den überregionalen Zeitungen ist es, als gäbe es diese Stellungnahme gar nicht. Als wäre die missliebige Information „zensiert“ worden.
Das ist kein Einzelfall.
Als vor gut zwei Jahren in einem außergewöhnlichen Schritt 24 Wirtschaftsverbände unter Federführung des Bundesverbandes der Industrie (BDI) eine „gemeinsame Erklärung“ herausgaben, in der sie ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger „vollständig“ ablehnten, berichteten darüber weder die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ noch die „Süddeutsche Zeitung“ noch die „Welt“.
Die Leser der FAZ erfuhren von der Existenz dieser Kritik nur indirekt zwei Monate später. In einem Interview wies der Verlegerpräsident Hubert Burda die Vorwürfe des BDI zurück — Vorwürfe, über die die FAZ nie berichtet hatte.
So ist das: Was den großen renommierten deutschen Zeitungen bei ihrem Kampf für ein Leistungsschutzrecht im Weg steht, findet in den großen renommierten deutschen Zeitungen im Zweifel nicht statt. Eine unabhängige, von Eigen-Interessen unbeeinflusste Berichterstattung kann man von ihnen nachweislich nicht erwarten. Manch einer irgendwo könnte da schon von „Zensur“ sprechen.
PS: Ich habe heute beim Zeitungsverlegerverband BDZV nachgefragt, wie man denn die furchteinflößende Äußerung zu verstehen hat, dass Google „noch zu viel mehr im Stande“ ist als die aktuelle Kampagne. Die Antwort:
Google hat in Deutschland unbestritten eine marktbeherrschende Stellung. Das versetzt das Unternehmen in die Lage, diese Kampagne im eigenen wirtschaftlichen Interesse massenwirksam zu fahren. Zugleich zeigt Google damit das Instrumentarium vor, das nötig ist, jede wie auch immer geartete Kampagne mit höchster Aufmerksamkeitswirkung durch den digitalen Flaschenhals zu lancieren.
Man kann das, sehr geehrter Herr Niggemeier, völlig in Ordnung finden, man kann das, wie die Zeitungs- und Zeitschriftenverleger, aufgrund der Vormachtstellung der Suchmaschine im Internet aber auch für einseitig und deshalb bedenklich halten. Unser Ziel ist es, eine ernsthafte Debatte anzustoßen und die von Google gesetzten Bedingungen nicht einfach nach dem Prinzip „Friss Vogel oder stirb“ zu akzeptieren.