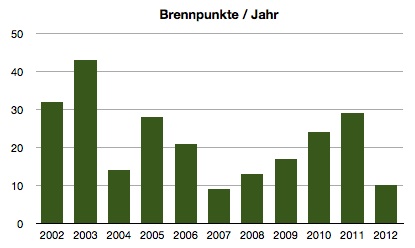Es ist unmöglich, auch nur im Ansatz all die Desinformationen zu dokumentieren oder gar zu berichtigen, die die deutsche Presse in diesen Tagen über die neue Haushaltsabgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbreitet. Ich habe das gestern im BILDblog wenigstens mit einigen Details aus der „Bild“-Kampagne versucht, aber es kommen jeden Tag neue Unwahrheiten nach.
Heute liefert der Medienredakteur und Widerstandskämpfer Hans-Peter Siebenhaar im „Handelsblatt“ ein besonders krasses Beispiel dafür, wie umfassend man die Leser (und natürlich andere vermeintliche Fachjournalisten) in die Irre führen kann, wenn man altbekannte Tatsachen als neu präsentiert und falsch interpretiert.
Sein Artikel beginnt so:
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten dürfen die erwarteten Mehreinnahmen durch die neue Rundfunkgebühr in Höhe von 304 Millionen Euro behalten. Davon entfallen auf die ARD 197,3 Millionen Euro, auf das ZDF 60,1Millionen und auf das Deutschlandradio 46,7 Millionen Euro im Zeitraum 2013 bis 2016. Das teilte gestern die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) in Mainz auf Anfrage des Handelsblatts mit.
Das ist fast schon preisverdächtig irreführend.
Verständnisfrage: Werden Mehreinnahmen in Höhe von 304 Millionen Euro erwartet? Oder dürfen die öffentlich-rechtlichen Anstalten von möglichen Mehreinnahmen in unbestimmter Höhe 304 Millionen Euro behalten?
Richtig wäre die zweite Interpretation, aber durch den bestimmten Artikel („die erwarteten Mehreinnahmen in Höhe von“) lenkt Siebenhaar die Leser in die andere, die falsche Richtung.
All die Zahlen, die Siebenhaar da nennt und die die KEF angeblich gestern seiner Zeitung mitteilte, stehen im 18. Bericht, den diese Kommission im Dezember 2011 vorgelegt hat. Sie stehen dort gleich auf der ersten Text-Seite. Sie geben die Finanzierungslücke an, die nach den Schätzungen der KEF bei ARD, ZDF und Deutschlandradio in den nächsten vier Jahren entsteht.
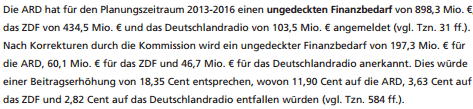
Normalerweise hätte die Rundfunkgebühr um 18, 35 Cent erhöht werden müssen, um diese Lücke zu schließen. Weil aber außer Burkhardt Müller-Sönksen und der „Bild“-Zeitung niemand weiß, wieviel Geld durch das neue Verfahren wirklich eingenommen wird (und weil es politisch so gewollt war), wurde die Höhe des Beitrages nicht angehoben.
Es sollte erst abgewartet werden, wie sich die Einnahmen tatsächlich entwickeln. Liegen sie über den Schätzungen, würde daraus der Finanzbedarf gedeckt. Kommt noch mehr Geld zusammen, als den öffentlich-rechtlichen zusteht, würde das bei der zukünftigen Festsetzung der Gebühren berücksichtigt: Sie würden weniger stark steigen oder sogar sinken. Kommt weniger zusammen, müssten sie entsprechend stärker steigen.
Das ist alles seit Jahren bekannt. Das ist das Wesen des ganzen Systems. Das Geld, das ARD und ZDF bekommen, richtet sich nicht danach, was eingenommen wird, sondern danach, was ihnen aufgrund ihrer Kosten zugestanden wird. Die seit Tagen anhaltende mediale Fixierung auf die mögliche Höhe der Einnahmen durch das neue System funktioniert als Skandalisierung nur, weil sie diesen Grundsatz ignoriert.
Deshalb kann Siebenhaar falsche und längst bekannte Tatsachen zu einer vermeintlichen Nachricht zusammenrühren. Er schreibt weiter:
Mittlerweile ist auch eine Reduzierung der monatlichen Rundfunkgebühr, früher als GEZ-Gebühr bekannt, kein Tabuthema mehr. „Wenn es zu deutlichen Mehreinnahmen kommt, ist auch eine Senkung der Rundfunkgebühren denkbar“, sagte KEF-Geschäftsführer Horst Wegner dem Handelsblatt. „Eine Gebührensenkung ist frühestens zum 1. Januar 2015 denkbar.“ Wenn eine Milliarde Euro mehr reinkommt, müssten diese Mehreinnahmen an die Gebührenzahler durch eine Gebührensenkung weitergegeben werden, sagte gestern ein KEF-Experte, der ungenannt bleiben will.
Schön dass der ungenannte KEF-Experte einfach noch einmal dasselbe sagt wie der genannte KEF-Experte. Aber da auch der genannte KEF-Experte nur sagt, was immer schon feststand (und keineswegs ein „Tabuthema“ war, wie Siebenhaar fantasiert), ist es eh wurscht. Redundanz wird erst in der Wiederholung richtig schön.
Apropos. Siebenhaar schreibt heute:
Für Unternehmen können die neuen Beiträge nach Berechnungen des Handelsblatts und von Wirtschaftsverbänden um den Faktor 17 höher ausfallen als die alten Gebühren. Die Deutsche-Bahn-Tochter DB Netz etwa zahlte bislang 26.000 Euro Rundfunkgebühren im Jahr, künftig werden es 472.000 Euro sein. Den Drogeriemarkt-Filialisten DM kosteten ARD und ZDF bislang 94.000 Euro, mit dem Jahreswechsel werden daraus 266.000 Euro. Deutschlands Lebensmittelhändler Rewe erwartet eine Kostensteigerung um 500 Prozent.
Nach früheren Berechnungen des Autovermieters Sixt drohen Bürgern pro Jahr Zusatzkosten von 600 Millionen Euro und Firmen von 950 Millionen Euro.
Gestern hatte Siebenhaar zusammen mit „Handelsblatt“-Kollegen geschrieben:
Für Unternehmen können die neuen Beiträge nach Berechnungen des Handelsblatts und von Wirtschaftsverbänden um den Faktor 17 höher ausfallen als die alten Gebühren. Die Deutsche-Bahn-Tochter DB Netz etwa zahlte bislang 26.000 Euro Rundfunkgebühren im Jahr, künftig werden es 472.000 Euro sein. Den Drogeriemarkt-Filialisten dm kosteten ARD und ZDF bislang 94.000 Euro, mit dem Jahreswechsel werden daraus 266.000 Euro. (…) Deutschlands Lebensmittelhändler Rewe erwartet eine Kostensteigerung um 500 Prozent. Nach früheren Berechnungen des Autovermieters Sixt drohen Bürgern pro Jahr Zusatzkosten von 600 Millionen Euro und Firmen von 950 Millionen Euro.
Neinnein, das ist nicht derselbe Text. Gestern war „DM“ klein geschrieben.
Vielleicht veröffentlicht das „Handelsblatt“ jetzt aus Protest gegen die Finanzierung von ARD und ZDF diese Absätze einfach täglich neu, angereichert mit Informationen, die man sich ein bis vier Jahre nach ihrer Veröffentlichung nochmal von den jeweiligen Behörden bestätigen lässt und dann falsch interpretiert.
Wenn Leser dafür tatsächlich Geld ausgeben, hätte das „Handelsblatt“ ein Finanzierungssystem für seine Propagandamaschine erfunden, das fast so zukunftssicher ist wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen.