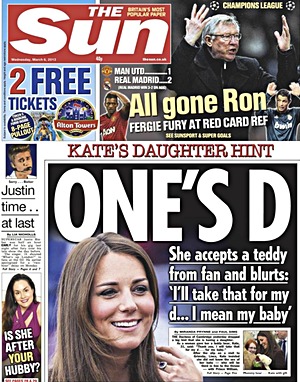Die Mail begann mit den Worten:
Hier ist (…), wir kennen uns leider noch nicht persönlich, aber natürlich weiß ich, dass du einer DER TV-Blogger in Deutschland bist.
Ein bisschen unglücklich war, dass sie an meinen Kollegen Peer adressiert war, aber mit den Worten „Hallo Peter“ begann. Und dass es etwas später in ihr hieß:
Vielleicht passt es in den FAZ Fernsehenblog, oder eine andere Platform für die du, oder Stefan schreibst.
(Das FAZ-Fernsehblog gibt es seit fast einem halben Jahr nicht mehr, und ich war sogar schon seit Herbst 2011 nicht mehr dabei.)
Der Absender, ein Mitarbeiter der PR-Agentur Platoon (Berlin/Seoul), schrieb, seine Aufgabe sei es, dem Start der Serie „Real Humans“ auf arte „ein wenig mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen“. Er habe einen Trailer und Informationen. Und:
Außerdem gibt es ein Budget mit dem ich arbeiten kann, falls dies von Interesse sei.
Ein ebenso rätselhafter wie verheißungsvoller Konjunktiv, da am Ende. Auf die Nachfrage, um was für ein Budget es sich handele, kam als Antwort:
Nun, dieses Projekt ist ein kleineres. Hier habe ich die Möglichkeit einen Tagessatz von 250.- Euro für einen Blogpost auszugeben. Aber im direkten Anschluss wird eine größere Sache für den gleichen Sender anlaufen. Vergleichbar mit dem BBC Science Format. Mehr kann ich dazu leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber darüber würde ich mich ebenfalls gerne mit dir unterhalten…
Ich hoffe die 250.- sind erstmal OK. Ich würde dir dann gleich das uns zur Verfügung stehende Material zusenden…
250 Euro sind mehr, als die meisten Tageszeitungen oder Online-Medien für eine Rezension der Sendung bezahlen würden.
Lässt arte Blogger oder Journalisten dafür bezahlen, dass sie über arte-Programme schreiben?
Die Pressestelle bestreitet das:
Nein, wir bezahlen keine Journalisten, um über ARTE zu schreiben. Blogger sprechen wir genau so wie andere Journalisten über klassiche Wege an: Meldung, Pressekonferenzen, Telefon. Nicht mehr und nicht weniger. Von Bezahlung war in der Pressestelle noch nie die Rede.
Die Marketingleute von arte hätten zwar Kontakt mit Platoon gehabt. Die Agentur sollte „Vorschläge für Marketing- und Socialmedia-Aktionen für ‚Real Humans‘ entwerfen“, aber „es gab und es gibt keinen Auftrag“.
Auch ein Schreiben von Platoon an andere Blogger, das scheinbar im Auftrag von arte auf die Sendung hinweist, aber auf den „Budget“-Hinweis verzichtet, sei nicht im Auftrag von arte verschickt worden und wäre vom Sender nicht autorisiert worden, sagt Paulus G. Wunsch, Leiter für Marketing und Sponsoring bei arte.
Auf Nachfrage bei Platoon, in wessen Auftrag sie tätig sind und von wem das Geld kommt, antwortet Agentur-Inhaber Christoph Frank:
wir versuchen gerade die marketing abteilung von ARTE als neu-kunden im bereich online-PR zu gewinnen.
dazu haben wir den freien mitarbeiter (…), in unser team genommen um pro-aktiv (ohne beauftragung) eine online PR-strategie zu erarbeiten und auszuprobieren.
ARTE hatte uns dafür bisher nicht beauftragt, sondern wir wollten uns positiv ins spiel bringen.
dieser schuss ging offensichtlich nach hinten los.
Meine Fragen, ob das Angebot, für Blogbeiträge zu zahlen, üblich sei und andere Journalisten das Angebot angenommen hätten, lässt er unbeantwortet.
Was für eine merkwürdige Geschichte. Platoon ist keine unbekannte Firma. Sie hat mit den Containern, aus denen sie in Berlin-Mitte arbeitet, von sich reden gemacht, und spielte in der arte-Reihe „Durch die Nacht mit…“ in einer Folge mit den Politikberatern Uwe-Carsten Heye und Michael Spreng eine größere Rolle. Die Agentur nennt sich heute „Platoon Cultural Development“ oder auch „Platoon Kunsthalle“.
Und die wollen so dringend mit arte ins Geschäft kommen, dass sie sogar eigenes Geld in die Hand nehmen und auf eigene Faust aktiv werden? Und stellen sich dabei, andererseits, so sensationell ungeschickt an, vom fehlerhaften Anschreiben bis zum plumpen Wedeln mit Geldscheinen?
Kann mir das jemand erklären?