Heute lernen wir, wie die ARD sich vorstellt, in Zukunft junge Zuschauer für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk begeistern zu können. Keine Sorge: Um Inhalte geht es dabei nicht.
Zur Einstimmung hilft eine Übung: Wir versuchen, die Digitalkanäle der ARD voneinander zu unterscheiden.
Lassen wir tagesschau24 mal weg, das ist zu leicht, da laufen den ganzen Tag Nachrichten und abends Wiederholungen aktueller Magazine, Talkshows und Dokumentationen.
Aber es gibt ja noch Einsfestival und EinsPlus.

Laut „Programmkonzept Digitale Fernsehprogramme der ARD“ ist Einsfestival ein „innovatives, kulturell orientiertes Angebot mit jüngerer Ausrichtung“. EinsPlus hingegen sei zu einem „öffentlich-rechtlichen Service-, Ratgeber- und Wissensangebot weiterentwickelt“ worden, „das schnell Akzeptanz bei den Fernsehzuschauern gefunden hat“.
| Marktanteile I/2013 |
| ZDFneo |
0,8 Prozent |
| ZDFinfo |
0,6 Prozent |
| ZDFkultur |
0,2 Prozent |
| Einsfestival |
0,3 Prozent |
| EinsPlus |
0,1 Prozent |
| tagesschau24 |
0,1 Prozent |
| Zuschauer ab 3 Jahren. Quelle: ARD |
EinsPlus brachte es im ersten Quartal 2013 auf einen Marktanteil von 0,1 Prozent. Das ist ungefähr das Maß an Zuschauer-„Akzeptanz“, das entsteht, wenn mehrere Leute beim Durchzappen versehentlich drei Sekunden bei einem Sender hängen bleiben.
Die Definitionen sind also offenbar nicht hilfreich. Die Namen schon gar nicht. Aber vielleicht hilft ein Blick ins Programm:
Auf EinsPlus läuft die „LateLine mit Jan Böhmermann“. Auf Einsfestival läuft der „1Live Talk“ mit Sabine Heinrich.
EinsPlus zeigt aktuelle Musikvideos in der Sendung „EinsPlus Charts“. Einsfestival zeigt aktuelle Musikvideos in der Sendung „Clipster“.
EinsPlus bringt „Es geht um mein Leben“ mit Pierre M. Krause. Einsfestival bringt die „SWR3 latenight“ mit Pierre M. Krause.
Gut, andererseits zeigt EinsPlus „Die allerbeste Sebastian Winkler Show“ am Dienstagabend und Einfestival am Donnerstagabend. Und der aktuelle „Tatort“ läuft auf Einsfestival am jeweiligen Sonntag nochmal um 21:45 und 23:45 Uhr und auf EinsPlus gar nicht.

Es hilft, das zu wissen, um zu verstehen, warum die Intendanten der ARD dem ZDF am Montag öffentlich vorgeschlagen haben, die jeweils drei Digitalkanäle der beiden zu fusionieren. Die ARD ist mit dem, was man euphemistisch eine Digital-„Strategie“ nennen könnte, umfassend gescheitert. Sie veranstaltet zwei Sender mit irreführenden Namen und unklarem Profil, die niemand auseinanderhalten kann und keiner guckt, sowie eine Nachrichtendauerschleife. Es gelingt ihr nicht, ein klares unterscheidbares Profil für die beiden Kanäle EinsPlus und Einsfestival zu entwickeln, weil das Konzept in Wahrheit darin besteht, dass das eine Programm vom SWR gemacht wird und das andere vom WDR.
Deshalb ist es für die ARD auch unmöglich, das zu tun, was naheliegend wäre: einen ihrer beiden Möchtegernjugendkanäle zu schließen. Denn dann müssten ja der WDR oder der SWR etwas aufgeben. Und wenn ARD-Anstalten so etwas könnten, gäbe es keine fünf wöchentlichen Talkshows und das ARD-Wirtschaftsmagazin „Plusminus“ würde nicht im Wechsel von fünf verschiedenen Moderatoren präsentiert.
Doch nun hat die ARD doch noch eine sinnvolle Verwendung für ihre vermurksten Digitalkanäle gefunden: Sie bietet an, sie zu opfern, und nutzt sie gleichzeitig als Pfand, um das ZDF in eine Senderehe zu zwingen.
Die ARD hat angesichts der dokumentierten Erfolglosigkeit ungefähr nichts zu verlieren, aber einiges zu gewinnen: Gemeinsam mit dem ZDF würde ein Neustart möglich, der nicht nur gesichtswahrend ist, sondern sogar imageträchtig: Es wirkt ungemein einsichtig und sparsam und politisch vorauseilend, mit dem Vorschlag, drei Sender einzusparen, nach vorne zu preschen. Gemeinsam könnten die Kanäle mehr Geld haben. Und auf eine bizarre Art ist es aus ARD-Sicht womöglich sogar tatsächlich einfacher, die Rivalitäten zwischen den eigenen Anstalten zu lösen, wenn man Gemeinschaftssender mit dem ZDF bildet.
Alles würde besser werden. Durch „intensivere Kooperationen“ wäre es möglich, die Digitalkanäle „weiter und besser zu profilieren“ — sagt der Senderverbund, dem es nicht einmal im Ansatz gelungen ist, zwei eigenen Kanälen ein eigenes Profil zu geben.
Wenn die sechs Digitalsender zu dreien zusammengelegt würden, biete das „die Chance zu einer weiteren Profilschärfung der schon bestehenden Gemeinschaftsprogramme Phoenix und 3sat“, träumt die ARD. Als ob es da bislang an „Chancen“ gemangelt hätte und nicht am Willen! Was die ARD und das ZDF bisher daran hindert, das Profil von Phoenix und 3sat zu schärfen, verrät die Pressemitteilung der ARD nicht.
Der Plan der ARD sieht vor, EinsPlus und ZDFkultur zu einem neuen Kanal für 14- bis 29-Jährige zu vereinen und Einsfestival und ZDFneo zu einem für 30- bis 49-Jährige. (Dass die ARD letztere als „jüngere Erwachsene“ bezeichnet, spricht Bände.)
Das öffentlich vorzuschlagen und das ZDF so unter Druck zu setzen, ist frech. Aber schon das Konzept auf der Grundlage einer solchen Altersaufteilung an sich ist Unsinn. Ist „Mad Men“ eine Sendung für 30- bis 49-Jährige? Wie groß ist die Übereinstimmung zwischen dem, was ein frisch Pubertierender und ein Familienvater mitten im Berufsleben sehen will? Angesichts der gründlich dokumentierten Schwierigkeit der Öffentlich-Rechtlichen, überhaupt Zuschauer unterhalb von 50 Jahren anzusprechen, wäre „ambitioniert“ ein schillernder Euphemismus für den Versuch, diese dann auch noch nach zwei Altersgruppen zu differenzieren.
Aber genau so scheint sich die ARD die zukünftige öffentlich-rechtliche Lebensbegleitung der Menschen vorzustellen. Erst gucken sie den gemeinsamen Kika, mit einsetzender Pubertät schalten sie zum gemeinsamen Jugendkanal um, mit 30 wechseln sie dann zum gemeinsamen jüngeren Älterenkanal.
Deshalb sei es auch keine Lösung, dass die ARD einfach einen ihrer Digitalkanäle abschalte und sich mit dem anderen auf ein junges Publikum konzentriert, sagte Lutz Marmor, der NDR-Intendant und amtierende ARD-Vorsitzende, heute Vormittag bei der Pressekonferenz nach der Frühjahrstagung der Intendanten: Wie soll das gehen? „Die ARD hat die ganz Jungen, und dann wechseln sie zu ZDFneo?“
Mit keinem Wort wurde bei der weit über einstündigen Pressekonferenz angesprochen, was jüngere Leute überhaupt sehen wollen, welche Formen der Ansprache richtig wären, welche Inhalte fehlen. „Die Zielgruppen fächern sich auf, deshalb brauchen wir Zusatzangebote für diese Zielgruppen“, sagte Marmor — als ließen sich diese Zielgruppen formal-technisch aufgrund ihres Alters unterscheiden.
Das ZDF hatte mit seinen Digitalkanälen ZDFkultur und ZDFneo ein besseres Konzept: ZDFkultur ist elitär, ZDFneo populär. Auf ZDFkultur liefen Konzerte, auf ZDFneo Serien wie „Mad Men“ und „30 Rock“. Gleich drei Sendungen von ZDFkultur sind in diesem Jahr für einen Grimme-Preis nominiert worden. Kein Wunder.
Dass das ZDF mit seinen Kanälen ungleich erfolgreicher ist als die ARD, liegt aber auch daran, dass es besonders schamlos ist, was das besinnungslose Wiederholen von zuschauerträchtigen Programmen angeht. Auf ZDFkultur läuft pro Woche 12-mal „Unser Charly“, 13-mal „Ein Heim für Tiere“, 15-mal „Tierarzt Dr. Engel“ und 39-mal die „Hitparade“. ZDFneo macht seine Quoten nicht zuletzt mit Wiederholungen von irgendeiner „Soko“, „Inspector Barnaby“, „Raumschiff Enterprise“ und der schon von RTL endlos wiederholten „Nanny“. Und ZDFinfo punktet mit Hitler.
Eigentlich hat der feine „Elektrische Reporter“ seine Heimat auf ZDFinfo. Sein origineller regulärer Sendetermin scheint inzwischen der Sonntagvormittag um 11:30 Uhr zu sein. ZDFinfo wiederholt die Sendung aber auch montags gegen 4:40 Uhr, mittwochs gegen 4:35 Uhr, donnerstags gegen 0:20 Uhr, samstags gegen 4:30 Uhr und sonntags gegen 4:45 Uhr. Es scheint eine interne Vorschrift zu geben, die Sendung nicht zu einer Zeit ins Programm zu nehmen, in der mehr als zwei Dutzend Menschen sie zufällig entdecken und schätzen lernen könnten.*
Was aus dem einstigen Anspruch (oder wenigstens: Versprechen) von ZDFneo („Wenn ich mich nur berieseln lassen will, geh ich unter die Dusche“) geworden ist, hat Peer Schader neulich anschaulich dokumentiert. Zwischen den ganzen Wiederholungen und dem „Hollywood-Freitag“ fand er in einer Woche exakt 45 Minuten neues eigenproduziertes Programm. Sein Fazit über den Kanal:
Bloß ein auf Quotenoptimierung getrimmter Programmplanersender, der sein Publikum ausschließlich als Zahl hinter der Kommastelle bei der Marktanteilsauswertung kennt.
Und ZDFkultur ist praktisch schon Geschichte: Der Sender, der mit seiner Spezialisierung insbesondere auf Musik immerhin eine klare Identität hatte, eine höchst öffentlich-rechtliche noch dazu, soll „so rasch wie möglich“ auf ein „Wiederholungs- und Schleifenmodell umgestellt werden“, wobei eh längst schon nicht mehr klar ist, woran man erkennen können sollte, wann damit begonnen wird.
Ausgerechnet diesen — von Intendant Thomas Bellut ungeliebten — Sender glaubt sich das ZDF nicht mehr leisten zu können. Und hat dadurch, dass es ihn quasi schon als eingestellt betrachtet, den Trumpf in der Hand, dass der Etat, den es nach den Träumen der ARD mit in eine Jugendkanalehe einbringen soll, gar nicht mehr vorhanden ist.
„Wir haben ein Manko“, sagte Marmor. „Wir haben kein klar definiertes Angebot für die ganz jungen, die 14- bis 29-Jährigen.“
Und ich dachte, dass EinsPlus genau so ein Angebot sein wollte und sich bloß mangels Ausstattung, Kreativität und Kompetenz dabei nicht gut anstelle.
Was hätte das ZDF davon, mit der ARD zu kooperieren? Marmor sagte, man könne sich heute schon vorstellen, wie attraktiv ein Sender wäre, der die Stärken, die ZDFneo und Einsfestival haben, kombiniert. Worin die „Stärken“ von Einsfestival aktuell bestehen, sagte er nicht. Andererseits deutete er an, dass sich, wenn man Einsfestival und ZDFneo zusammenlegte, vielleicht Geld sparen könnte, das man dann wiederum in den Jugendkanal stecken könnte.
Wie sich tagesschau24 und ZDFinfo sinnvoll zusammenlegen ließen, weiß die ARD auch noch nicht. Aber das klingt natürlich erstmal gut, und der Privatsenderverband VPRT klatschte prompt Beifall.
Die Diskussion um die Zahl der Digitalkanäle ist ohnehin irreführend. Es kommt nicht darauf an, ob es sechs sind, fünf oder drei, sondern darauf, wie die Sender sie nutzen und ob sie einen klaren Mehrwert darstellen, und sei es auch nur für eine kleine Gruppe. ZDFkultur hat das im Ansatz gezeigt. Aber ZDFkultur wird gerade abgewickelt.
*) Nachtrag, 16:30 Uhr. ZDFinfo weist mich darauf hin, dass der „Elektrische Reporter“ um 0:20 Uhr nicht versteckt wird, sondern dort erwiesenermaßen mehr Zuschauer finde, auch in absoluten Zahlen, als wenn er nicht so spät in der Nacht liefe.
 So argumentieren sinngemäß die Anwälte des Gruner+Jahr-Blattes in einem Prozess, der in dieser Woche in die zweite Runde geht. Christian Jungblut, ein altgedienter Reporter und langjähriger „Geo“-Mitarbeiter, hatte gegen die Zeitschrift geklagt, weil sie sich nicht davon abbringen ließ, einen Artikel von ihm in Heft 12/2009 in einer grundlegend veränderten und für ihn nicht akzeptablen Fassung unter seinem Namen zu veröffentlichen. In der ersten Instanz hatte ihm das Landgericht Hamburg
So argumentieren sinngemäß die Anwälte des Gruner+Jahr-Blattes in einem Prozess, der in dieser Woche in die zweite Runde geht. Christian Jungblut, ein altgedienter Reporter und langjähriger „Geo“-Mitarbeiter, hatte gegen die Zeitschrift geklagt, weil sie sich nicht davon abbringen ließ, einen Artikel von ihm in Heft 12/2009 in einer grundlegend veränderten und für ihn nicht akzeptablen Fassung unter seinem Namen zu veröffentlichen. In der ersten Instanz hatte ihm das Landgericht Hamburg  Die Diskussion um das Urteil lieferte einen erhellenden Blick in die erstaunlichen Umgangsformen hinter den Kulissen der Zeitschrift, die in den vergangenen Jahren rasant Käufer verloren hat und es gerade mit der „Focus“-haften (und inhaltlich komplett irreführenden) Titelzeile
Die Diskussion um das Urteil lieferte einen erhellenden Blick in die erstaunlichen Umgangsformen hinter den Kulissen der Zeitschrift, die in den vergangenen Jahren rasant Käufer verloren hat und es gerade mit der „Focus“-haften (und inhaltlich komplett irreführenden) Titelzeile 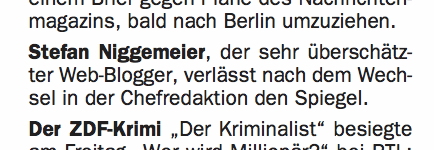
 Was ich dann stattdessen mache, kann ich noch nicht verraten. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ich auch in Zukunft gelegentlich frei für den „Spiegel“ schreibe. Die Titelgeschichte
Was ich dann stattdessen mache, kann ich noch nicht verraten. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ich auch in Zukunft gelegentlich frei für den „Spiegel“ schreibe. Die Titelgeschichte 







 Und manchmal von ausgesuchter Ekligkeit, wenn die „Freizeit Monat“ auf ihrem Titel alles tut, um den Eindruck zu erwecken, dass Friso, der Sohn von Beatrix, der seit einem Unfall im Koma liegt, gestorben sei, wenn sie in Wahrheit nur die angekündigte Abdankung der niederländischen Königin meint.
Und manchmal von ausgesuchter Ekligkeit, wenn die „Freizeit Monat“ auf ihrem Titel alles tut, um den Eindruck zu erwecken, dass Friso, der Sohn von Beatrix, der seit einem Unfall im Koma liegt, gestorben sei, wenn sie in Wahrheit nur die angekündigte Abdankung der niederländischen Königin meint.