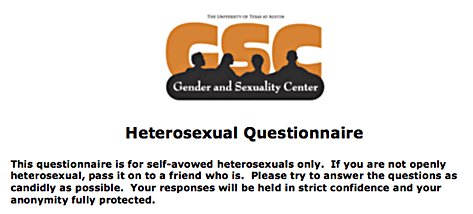Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Ist das wirklich das Jahr 2014? Ist es wirklich wahr, dass Homosexualität zwar geduldet wird – aber nur dann, wenn Lesben und Schwule möglichst unsichtbar bleiben? Ein paar notwendige Worte zum Kulturkampf.
Johann Wolfgang Goethe hätte der Diskussion gutgetan. Gleich am Anfang der Talkshow von Sandra Maischberger in dieser Woche, als sich die Runde hoffnungslos in der Frage verhedderte, ob man von den Menschen verlangen dürfe, dass sie Homosexualität akzeptieren, oder nur, dass sie sie tolerieren.
Die konservative Journalistin Birgit Kelle hatte auf dieser Unterscheidung bestanden und bot Toleranz, aber keine Akzeptanz. Sie müsse bestimmte Dinge hinnehmen, sagte sie, aber sie müsse sie nicht gut finden. Akzeptanz aber würde bedeuten, „dass ich meinen Standpunkt ändern muss“.
Aber dann sollte sie sagen, ob sie die Travestiekünstlerin Olivia Jones „akzeptiert“ oder „toleriert“, und Maischberger stolperte darüber, dass sie nicht wusste, ob sie den als Frau auftretenden Mann nun als „er“ oder „sie“ bezeichnen sollte, und Frau Kelle verwirrte mit dem Satz, sie müsse ja auch andere politische Meinungen innerhalb des demokratischen Spektrums nicht „akzeptieren“, und die kleine Chance, an einem entscheidenden Punkt der Debatte für Klarheit zu sorgen, verpuffte im allgemeinen Durcheinander.
Goethe hätte geholfen. In seinen „Maximen und Reflexionen“ findet sich der Spruch: „Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.“
Was er meint, hat der Philosoph und Politikwissenschaftler Rainer Forst anhand von Beispielen aus der Geschichte erläutert. Dem Edikt von Nantes etwa, mit dem Heinrich IV. den protestantischen Hugenotten im katholischen Frankreich 1598 religiöse Toleranz gewährte. Das erlaubte ihnen innerhalb enger Grenzen die Ausübung der Religion, machte aber die Ausbreitung des Protestantismus gleichzeitig faktisch unmöglich. Es erkannte die Hugenotten als Staatsbürger an, fixierte aber ihren Status als Staatsbürger zweiter Klasse.
Oder die „Toleranzpatente“ des deutschen Kaisers Joseph II. von 1781, die es drei christlichen Minderheitskonfessionen in den Habsburger Erbländern erlaubten, ihre Religion auszuüben – im Privaten. Ihre Kirchen durften keine Glocken haben und keinen Eingang von der Straße.
Diese „Toleranz“ war für die betroffenen Minderheiten ein großer Fortschritt. Sie bedeutete das Ende der Verfolgung. Aber sie zementierte zugleich die Ungleichheit. Rainer Forst spricht von „Inklusion bei gleichzeitiger Exklusion“.
Toleranz in diesem Sinne bedeutet, etwas, das man ablehnt, aus pragmatischen Gründen hinzunehmen. Es bedeutet ausdrücklich nicht, es als gleichwertig zu akzeptieren.
Die Begriffe „Toleranz“ und „Akzeptanz“ werden im Alltag so unscharf und austauschbar verwendet, dass der Versuch aussichtslos ist, den Unterschied anhand der Wörter zu erklären. Aber die verschiedenen Konzepte lassen sich sehr klar beschreiben. Konservative wie Birgit Kelle sind bereit, Homosexualität als Tatsache hinzunehmen, und sie sind sogar dafür, dass Homosexuelle nicht mehr verfolgt werden. Aber sie lehnen es scharf ab, Lesben und Schwule und deren Partnerschaften als gleichberechtigt anzuerkennen. Und sie gehen auf die Barrikaden, wenn der Staat den Kindern in den Schulen vermitteln will, dass es „sexuelle Vielfalt“ gibt und dass andere Identitäten als die heterosexuelle nicht minderwertig sind.
Sie lehnen es ab, mehr zu sein als tolerant. Und vor allem lehnen sie es ab, dass der Staat es ist oder wird.
Das ist im Kern der Kulturkampf, der da tobt. Die Menschen, die in Baden-Württemberg und anderswo auf die Barrikaden gehen, kämpfen für das Recht, Homosexualität und Homosexuelle „nicht gut“ finden zu müssen (als ergäbe das irgendeinen Sinn). Sie sind oder geben sich insoweit tolerant, als sie Lesben und Schwule nicht mehr verfolgt wissen wollen. Aber sie sagen: Das muss jetzt gefälligst reichen!
Und die Lesben und Schwulen und ihre liberalen Verbündeten sehen, dass diese Art von Duldung eine Beleidigung ist, und sind nicht mehr bereit, das zu akzeptieren. Es geht um das Ende der Toleranz, auf beiden Seiten.
Ironischerweise können die Leute auf beiden Seiten gerade nicht fassen, was für eine Debatte da gerade stattfindet. Auf der einen Seite die, für die der Umgang mit sexueller Vielfalt längst selbstverständlich ist und die nicht glauben können, dass das in öffentlich-rechtlichen Talkshows im Jahr 2014 noch ein umstrittenes Thema sein könnte. Und auf der anderen Seite die, die eigentlich der Meinung sind, dass dem Thema ohnehin zu viel Aufmerksamkeit zuteil wird, und die doch eigentlich dafür kämpfen, dass sie (und ihre Kinder!) nicht dauernd damit behelligt werden.
Die aufgeklärten Homosexuellen-Gegner von heute haben nichts dagegen, wenn Lesben und Schwule ihre Veranlagungen im Privaten ausleben, solange sie dabei keine Glocken läuten. Aber es ist schon zu viel, wenn ein Unternehmen wie Facebook seinen Nutzern die Möglichkeit bietet, sich auf der Seite nicht mehr als „Mann“ oder „Frau“ identifizieren zu müssen, sondern aus Dutzenden teils sehr spezifischen Geschlechtskategorien diejenigen zu wählen, die sie am besten beschreiben. Angeboten werden etwa: „Gender Fluid“, „Trans Person“ und „Neutrois“.
Jeder Facebook-Nutzer darf weiter einfach „Mann“ oder „Frau“ bleiben, und trotzdem fühlen sich die, denen das als Beschreibung völlig ausreicht, und die finden, dass das gefälligst auch für alle anderen ausreichen sollte, von der neuen Wahlmöglichkeit unterdrückt. „Ich will mich gar nicht erst zu sehr darüber auskotzen“, schreibt sofort ein Kommentator auf „Zeit Online“ unter die Meldung von dem neuen Auswahlfeld: „ich finde es nur unsäglich bis unerträglich, wie penetrante, laut schreiende, winzige Minderheiten die große Mehrheit tyrannisieren.“
Das ist keine Einzelmeinung. Eine vernehmlich große Gruppe von Menschen fühlt sich tyrannisiert und als Opfer.
Sie können es nicht fassen, welche öffentliche Aufmerksamkeit der Fußballspieler Thomas Hitzlsperger für sein Coming-out erfahren hat: dass er so viel Anerkennung dafür bekam, dass er sichtbar machte, was nach ihrer Ansicht vielleicht zu tolerieren ist, aber nicht in die Öffentlichkeit gehört.
Dahinter steckt oft auch ein Missverständnis darüber, worüber wir reden, wenn wir über Homosexualität reden. Es geht nicht um Sexualität im Sinne irgendwelcher Praktiken, nicht um Einblicke in das Intimleben eines Menschen. Es geht um einen elementaren Teil seiner Identität, um Aspekte seines Lebens, die bei Heterosexuellen völlig selbstverständlich Teil des öffentlichen Lebens sind.
Der Sozialpsychologe Ulrich Klocke hat auf „Zeit Online“ in diesen Tagen in einem lesenswerten Beitrag erklärt, woher Homophobie kommt und wie sie zu heilen wäre, und dabei erst einmal aufgezählt, wie penetrant Heterosexualität im Alltag zur Schau gestellt wird: „Paare, die händchenhaltend flanieren; Kolleginnen, die auf der Arbeit von ihrem Freund erzählen; Politiker, die auf Wahlplakaten mit Frau und Kindern posieren; Tanten, die ihren Neffen fragen, ob er schon eine Freundin hat.“ Geht es um Homosexualität, ist all das gleich eine Zumutung, ein öffentliches Zurschaustellen von eigentlich höchst Privatem, eine Diskussion über Sex, vor der zum Beispiel Kinder geschützt werden sollen.
Diejenigen, die Homosexualität „tolerieren“, fühlen sich genervt, wenn ein Prominenter öffentlich sagt, dass er schwul ist, obwohl er damit weniger über sein Privatleben sagt, als wenn er sich mit seiner Freundin auf dem roten Teppich zeigen würde. Klaus Wowereit musste sich von Guido Westerwelle vor dessen Coming-out noch öffentlich als eine Art Exhibitionist darstellen lassen, der sein „Schlafzimmer“ ausstellt.
Natürlich ist die Aufmerksamkeit, die Hitzlspergers Coming-out bekommen hat, übertrieben. Natürlich wird der dritte, fünfte oder neunte prominente Fußballspieler, der vielleicht irgendwann mal sein Schwulsein öffentlich macht, keine große Nachricht mehr sein, sondern nur noch eine kleine. Aber Normalität wird auch dann nicht bedeuten, seine Homosexualität gar nicht mehr öffentlich zu machen.
Dabei war das die paradoxe Hoffnung, die sich für Konservative mit der Toleranz gegenüber Homosexuellen verband: dass Schwule und Lesben, wenn sie nicht mehr verfolgt werden, wieder unsichtbar würden.
Der leitende „Weltwoche“-Redakteur Philipp Gut hat das in einem Aufsatz, den die „Welt“ nachdruckte, schon vor fünf Jahren in besonders entlarvender Weise formuliert. Er beschwerte sich, dass es alle möglichen Interessenvertretungen gibt, „von den Schwulen Eisenbahnfreunden in Deutschland über die Schwulen Väter und den LesBiSchwulen Jugendverband bis zu schwulen Offizieren und Polizisten“. Er beschwerte sich über den Lehrer, der seiner Klasse schon am ersten Schultag erzählte, dass er schwul sei, und über die Christopher-Street-Day-Paraden. Er schrieb: „Nach der erfolgreichen Emanzipation der Schwulen dürfte man eigentlich erwarten, dass die Homosexuellenbewegung etwas lockerer wird. Welche Bedeutung hat die penetrante, ja das öffentliche Leben bedrängende ,Sichtbarkeit‘ noch?“
Er wollte nicht verstehen, dass die „Sichtbarkeit“ von Lesben, Schwulen, Trans- und Intersexuellen nicht nur Mittel zum Zweck der Emanzipation ist, sondern ihr Ziel.
Diese Sichtbarkeit empfinden die toleranten Homo-Gegner als Belästigung und als Bedrohung; und die Versuche, Kindern und Jugendlichen sexuelle Vielfalt gleich als Selbstverständlichkeit zu vermitteln, als einen Angriff auf ihr gottgegebenes Recht, Homosexuelle und deren Liebe weiter als unnormal und defizitär abzuwerten. Sie fühlen sich in ihrer Toleranz verraten: So wie für die tolerierten religiösen Minderheiten vor zweihundert oder vierhundert Jahren die Pflicht galt, keine neuen Anhänger zu werben, sollten auch Lesben und Schwule ihren vermeintlichen „Lebensstil“ nicht als „erstrebenswert“ anpreisen dürfen – als ließe sich homosexueller Nachwuchs anwerben.
Vorgestern sprach die 26-jährige kanadische Schauspielerin Ellen Page auf einer Veranstaltung der LGBT-Bürgerrechts- und Lobby-Organisation Human Rights Watch, und man hörte ihrer Stimme an, wie aufgeregt sie war. „Ich will mich nicht mehr verstecken und lügen“, sagte sie. „Ich bin homosexuell.“ Die Zuhörer im Saal sprangen auf und jubelten ihr zu.
Es wird Leute geben, die das wieder missverstehen und glauben, dass da jemand dafür gefeiert wird, dass sie lesbisch ist, und die sich in ihrem Wahn bestätigt sehen, dass es so weit kommen werde, dass man sich dafür entschuldigen müsse, Hetero zu sein. Und die nicht sehen, dass Ellen Page dafür gefeiert wird, dass sie endlich einfach das tut, was für Heterosexuelle völlig alltäglich und selbstverständlich ist, aber anscheinend selbst für kanadische Schauspielerinnen immer noch Mut erfordert.