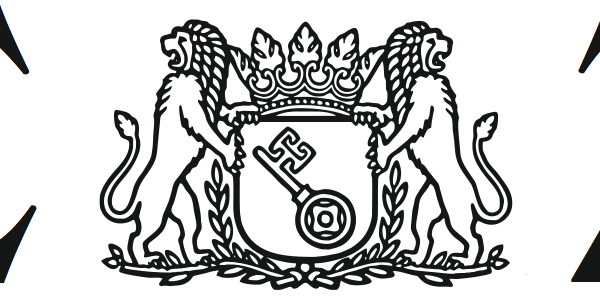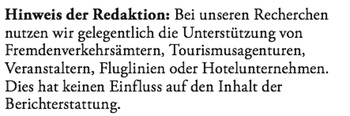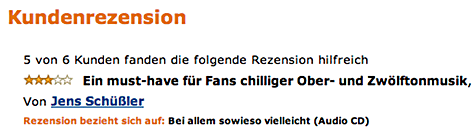Es ist gestern also wieder zu einem schlimmen Fall von Zensur gekommen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, zu einem Rückfall in finsterste Zeiten, beziehungsweise einem Vorgeschmack auf die totalitäre Zukunft dieses Landes. Das ZDF lieferte den endgültigen Beweis, dass „das Staatsfernsehen von diesen grün-rot versifften Wichsern beherrscht wird“ und dort inzwischen „hammerharte, primitive Zensur“ herrscht.
Der das sagt, muss es wissen, denn er wurde ihr vermeintliches Opfer: Akif Pirinçci.
Der aus der Türkei stammende Katzenkrimi-Schriftsteller veröffentlicht seit einiger Zeit wortgewordene Hassausbrüche; Texte für Leute, denen verbale Auseinandersetzungen, die nicht einer besinnungslosen blutigen Straßenschlacht gleichen, zu intellektuell sind.
Vor einem Jahr hat er unter dem Titel „Das Schlachten hat begonnen“ von einem „schleichenden Genozid“ geschrieben: Banden mordender junger Muslime zögen durch Deutschland, um die deutschen Männer auszurotten und die deutschen Frauen zu vergewaltigen. Und dass es dafür keine Beweise gebe, sei der beste Beweis: Behörden und Medien hätten sich verschworen, diesen Bürgerkrieg und Völkermord zu verschweigen.
Selbst auf der brachial-liberalen Internetplattform „Die Achse des Guten“, wo der Gastbeitrag erschien, gab es dafür heftigen Widerspruch: Tobias Kaufmann schrieb, er sei „zutiefst erschüttert“, dass ein solcher Text hier erscheinen konnte. Pirinçci habe „samt und sonders Standardrhetorik der NPD und anderer Neonazis“ benutzt.
Nun hat der Schriftsteller seine Wut als Buch veröffentlicht. Es heißt „Deutschland von Sinnen – Der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer“ und führt die Amazon-Bestsellerliste an. Und beim fröhlichen „Mittagsmagazin“ des ZDF dachte man sich: Hey, laden wir den lustigen Mann doch mal ein.
Was dann passierte, hat nichts mit Zensur zu tun. Es war vielmehr eine erschütternde Demonstration, wie unfähig das öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist, mit einem Hassprediger wie Pirinçci umzugehen. Wie überfordert die Verantwortlichen sind. Wie sehr sie solchen Leuten auf den Leim gehen. Und wie sie es schaffen, ihnen immer noch neue Munition zu liefern.
Vorgestellt wird er in einem Filmbeitrag, der mit den Worten endet: „So schonungslos hat noch keiner über Türken in Deutschland geschrieben.“ Damit hat man schon den Ton gesetzt: Pirinçci schreibt „schonungslos“. Das suggeriert, dass er Dinge sagt, die schmerzhaft sind, aber wahr. „Bild“ und andere sprechen da gern ähnlich affirmativ von „Klartext“.

Susanne Conrad, die Moderatorin, hat sich als Gesprächstaktik offenbar vorgenommen, ihn wie ein etwas lärmendes und gelegentlich zu Flatulenzen neigendes possierliches Tier zu behandeln. Man trifft sich in der entspannten Plauderposition in der absurden virtuellen Studiohölle. Sie fragt ihn, was ihm so sehr an Deutschland gefalle, und Pirinçci nutzt die erstbeste Gelegenheit, die kuschelige Atmosphäre aufzubrechen:
Pirinçci: Diese Wälder. Das ist so ein grünes Land. Wahnsinn. Leider wird ja durch diese grüne Ideologie die Wälder nach und nach wieder abgeholzt, damit man da Windmühlen hinstellen kann oder sowas. Also, diese Quatschenergie, dieser erneuerbare oder verteuerbare Energie-Mist.
Oh, hoppla. Hoppla? Nein, Frau Conrad entscheidet sich, das als kleinen Provokationsrülpser zu ignorieren und fährt lächelnd fort.
Conrad: Bleiben wir aber doch nochmal bei der Erfahrung, die Türken hier in Deutschland machen. Bei Ihnen ist das offenbar alles gut gelaufen …
(Lustig, ich habe gerade den gegenteiligen Eindruck, aber gut.)
Conrad: … aber es gibt, gerade oft in der dritten Generation, junge Menschen, die fühlen sich zerrissen. Die haben das Gefühl, sie sitzen kulturell, aber auch sprachlich zwischen allen Stühlen. Was ist denn da schief gelaufen?
Pirinçci: Da ist gar nichts schief gelaufen, die fühlen sich auch nicht zerrissen, sowas gibt’s in Wirklichkeit gar nicht. Das reden sie den Deutschen nur ein, damit sie von hinten bis vorne bedient werden, ja? (…) Das sind eigentlich Quatschbehauptungen von Soziologen, dass sie sich innerlich zerrissen fühlen würden, dass wenn sie über die Straße gehen, sich fragen würden: Bin ich ein Türke oder ein Araber oder ein Deutscher, oder sowas.“
Pirinçci entwickelt dann die These, dass Soziologieinstitute sich den „ganzen Blödsinn“ nur ausdenken, weil sie dafür ja Geld vom Staat bekommen und das den Politikern dann wiederum einreden.
Pirinçci: Sowas gibt’s gar nicht, wie eine Identität. Man ist da, wo man lebt halt.
(Bitte einmal kurz innehalten und die intellektuelle Brillanz dieses Mannes würdigen. Danke.)
Pirinçci: Abgesehen davon — wenn sie sich so zerrissen fühlen, dann können sie abhauen zu ihrer Heimat wieder, ganz einfach.
Immerhin wirft Frau Conrad hier kurz ein, dass das ja der Spruch sei, mit denen man früher Kritiker gen DDR verwünschte, aber das stört weder sie noch ihn ernsthaft. Pirinçci ist jetzt in Fahrt:
Pirinçci: Als wir [aus der Türkei nach Deutschland] kamen, waren wir für die Deutschen da. Man wollte von meinen Eltern die Arbeitskraft. Das hat sich durch die grün-versiffte Politik, grün-rot-versiffte Politik alles umgedreht. Das Einwanderungsland ist jetzt für die Einwanderer da. Die nächste Stufe wird sein, dass man sie zu Heiligen oder sowas erklärt.
Dies wäre eine gute Gelegenheit gewesen für Frau Conrad, die Provokationen ihres Gastes nicht einfach nur wegzulächeln, sondern mal nachzufragen: Was das denn sein soll, „grün-versiffte“ Politik, aus welchen rechtsradikalen Foren er diesen Ausdruck übernommen hat, warum er glaubt, dass es hilfreich ist, auf dieser Ebene zu diskutieren. Aber sie sitzt ja in der kuscheligen Plaudersituation neben Pirinçci, und sie traut sich nicht einmal, ihn direkt herauszufordern, sondern flüchtet sich in den rhetorischen Trick, anzunehmen, dass irgendwelche Leute das womöglich, aus nicht näher zu benennenden Gründen, gar nicht so gut finden könnten, was er da sagt. Wörtlich:
Conrad: Was Sie hier natürlich machen, das sind Ihre Ansichten und Überzeugungen, politisch sehr unkorrekt, ja? Also, da kann ich mir vorstellen, stehen viele jetzt schon auf den Barrikaden und sagen: Wie kann der sowas von sich geben? Insgesamt geht es in Ihrem Buch ja jetzt nicht nur um Migranten, sondern überhaupt um diese Gutmenschen und diese Politisch Korrekten. Sind das die Deutschen, die da besonders …
Wirkt, wenn man nicht genau hinhört, als habe Conrad ein Stück journalistischer Distanz bewiesen. In Wahrheit fragt sie ihn aber nicht, warum er so ist, sondern, warum die anderen so sind, diese [sic!] „Gutmenschen“.
Pirinçci: Das ist vor allem, wie gesagt, die grün-rot versiffte Politik, die mittlerweile auch die CDU, die sogenannte konservative Partei, absolut unkenntlich gemacht hat. Sie werden in der CDU keinen einzigen mehr finden, der über diese Abtreibungssache noch ein Wort verliert. Ich glaube, letztens hat mal einer mal aufgemuckt oder so und gesagt, ich bin damit nicht einverstanden, den haben sie sofort wieder zusammengeknüppelt. Und, ja, man kann sagen, die Kindersexpartei, die Grünen, haben dieses Land kaputtgemacht.
Die Grünen, die Kindersexpartei. Was macht die Moderatorin? Ihn zur Ordnung rufen, um Mäßigung bitten, wenigstens mal nachfragen, was er damit meint? Nein. Das Äußerste, wozu Sie sich durchringen kann, ist, seine Possierlichkeit festzustellen:
Conrad: Also, man merkt, wenn wir uns hier unterhalten, da ist sehr viel Aggression und Wut. Ich glaub‘, Thilo Sarrazin wirkt wie ein Weichei gegen sie. (Lacht.)
Sie schafft es nicht, sich mit ihm auseinanderzusetzen, seinen Thesen, seiner Rhetorik. Sie ist ihm nicht nur nicht gewachsen, sie kapituliert schon vor dem Versuch.
Immerhin schafft sie es später, noch sachte nachzufragen, ob das „alte Deutschland“, das er wiederhaben will, das „Deutschland der sechziger Jahre“ sei, was eine vergleichsweise berechtigte und hilfreiche Frage ist. Aber er biegt dann sofort wieder ab und erzählt verschmitzt, dass sein Buch auch von öffentlich-rechtlichen Sendern handele:
Pirinçci: Das Kapitel heißt: Mit dem Arschloch sieht an besser.
Jahahaha, das ist lustig. Frau Conrad hat dazu nichts zu sagen.
Conrad: Akif Pirinçci, jedenfalls war es interessant, Ihre Thesen hier zu hören. „Deutschland von Sinnen“ heißt das wahrscheinlich politisch unkorrekteste Buch des Jahres hier in Deutschland. Ich bedanke mich, dass Sie heute da waren, und wir werden das weiter im Auge behalten.
Das ist das Tolle an dem Kampfbegriff der „Political Correctness“. Frau Conrad kann so tun, als habe sie den Superlativ als Warnung und Distanzierung von dem Werk gebraucht. In Wahrheit ist er für die Zielgruppe die beste Werbung.
Schon bis hierher war es ein trauriges und eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks unwürdiges Spektakel. Die Verweigerung einer Auseinandersetzung. Wenn man meint, dass es sich lohnt, über die Aussagen Pirinçcis zu streiten, trotz des übelsten Tonfalls, in dem er sie vorträgt, muss man eben auch in diesen Streit gehen.
Aber das ist natürlich Alltag in dieser Art des besinngslosen Fernsehens: Da wird irgendwer eingeladen, man redet irgendwas, vorher war der Sportblock, danach kommen noch ein paar bunte Beiträge, und dazwischen sitzt da wer, mit dem man das Führen eines Gespräches simuliert, egal, es geht um nichts, war was?
Nun ist aber offenbar jemandem beim ZDF aufgefallen, dass da was war. Dass es dann doch keine ganz normale Gesprächssimulation war, und dass vielleicht doch ein Grenze überschritten wurde, ab der Frau Conrad das vielleicht nicht alles nur hätte weglächeln sollen.
Und so nahm der Sender das Gespräch aus der Mediathek. Und all die Leute, die ohnehin glauben, dass es ein Meinungsdiktat gibt in Deutschland und einen Tugendterror, fühlten sich bestätigt und schrien: Zensur! Das ZDF veröffentlichte dann den Gesprächsteil einzeln wieder, aber gekürzt um eine Stelle: Den vermutlich justiziablen Satz von den Grünen als „Kindersexpartei“, die dieses Land kaputt gemacht hat.
Beruhigen konnte das niemanden mehr, im Gegenteil. Und Pirinçci durfte also nicht nur seinen Hass im deutschen Fernsehen unwidersprochen und kaum hinterfragt ausbreiten, sondern auch den scheinbaren Beweis führen, dass man sowas im deutschen Fernsehen nicht sagen darf.
Dem ZDF sei Dank. 
Nachtrag, 15:50 Uhr. Auf Nachfrage teilt mir das ZDF mit:
Mit brisanten Themen kritisch umzugehen und hart nachzufragen gehört zu den Grundprinzipien der politischen Berichterstattung im ZDF. Unter dieser Maßgabe hat sich die Redaktion im Nachgang mit dem Interview selbstkritisch auseinandergesetzt und die Defizite offen diskutiert.
Die rechtliche Bewertung des Interviews hat gezeigt, dass die vollständige Einstellung des Gesprächs in die ZDF-Mediathek zu rechtlichen Risiken für das ZDF führen würde. Grund dafür ist, dass die Rechtsprechung an Aussagen in Live-Interviews einen großzügigeren Maßstab anlegt als an zeitversetzt ausgestrahlte oder zum Abruf bereitgehaltene Sendungen. Die Kürzung erfolgte also in Wahrnehmung unserer redaktionellen Verantwortung und ist selbstverständlich keine Zensur. Bis auf den fraglichen Halbsatz steht das Interview seit gestern, 17:30 Uhr, in der Mediathek.
Die Anschuldigungen von Herrn Pirincci weisen wir zurück. Die Standardlänge von Autorengesprächen im „ZDF-Mittagsmagazin“ sind 5 bis 7 Minuten. Herrn Pirincci wurden keine 15 Minuten zugesagt.
Fragen von mir, ob man den Umgang mit dem Schriftsteller und seinen Thesen angemessen fand, ließ das ZDF unbeantwortet. Womöglich darf oder soll man in die ersten beiden Sätze der Stellungnahme interpretieren, dass auch nach Auffassung der Redaktion die „Grundprinzipien der politischen Berichterstattung im ZDF“ nicht vollumfänglich erfüllt wurden. Aber wer weiß es, es ist halt das ZDF.