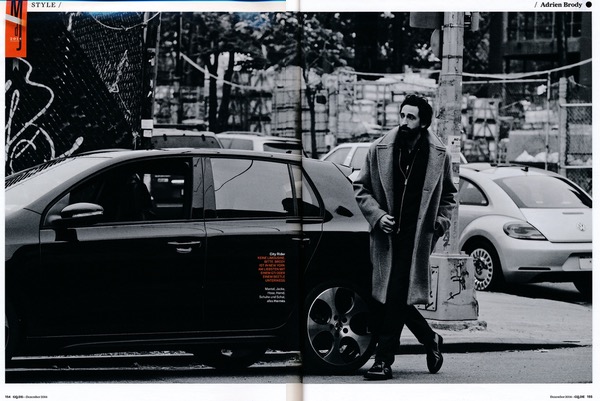Krautreporter
Hat jeder Hund eine von sieben angeborenen Positionen im Rudel? Und bestimmt diese Position sein Verhalten und seine Bedürfnisse mehr als Rasse und individueller Charakter? Die Theorie von den „angeborenen Rudelstellungen“ sorgt für heftige Kontroversen unter Hundehaltern.

„Doppelbesatz“ ist das Schlimmste. Wer bei seinen Hunden einen „Doppelbesatz“ hat, kann alle Hoffnung fahren lassen. Die Tiere werden nicht glücklich werden. Wenn sie noch glücklich sind, werden sie es nicht bleiben. Und wenn sie doch glücklich scheinen, machen sie uns nur was vor.
Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob man bei seinen Hunden einen solch fatalen „Doppelbesatz“ hat. Man muss sie von Barbara Ertel einschätzen lassen.
Barbara Ertel glaubt, dass jeder Hund mit einer von sieben fest vererbten Positionen im Rudel auf die Welt kommt. Die verschiedenen Stellungen haben unterschiedliche Aufgaben und die Hunde entsprechend unterschiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten. Hat man zwei Hunde mit derselben Stellung, ist das ein „Doppelbesatz“ – und, naja, wie gesagt. Die müssen getrennt werden. Sofort. Und für immer. Wenn einem seine Hunde am Herzen liegen.
Dass es „vererbte Rudelstellungen“ gibt und diese das Verhalten von Hunden entscheidend prägen, hat Barbara Ertel nach eigenen Angaben Ende der sechziger Jahre als junge Frau bei einem Züchter von Eurasier-Hunden in Hessen gelernt. 45 Jahre danach macht diese Theorie Furore in Deutschland – und sorgt für heftige Kontroversen. Wissenschaftler halten sie für abwegig oder gar gefährlich; Kritiker erinnert die „Rudelstellung“-Szene an eine Sekte. Aber der radikal andere Blick auf unsere Hunde scheint eine erhebliche Anziehungskraft zu haben – und sogar das ZDF hat seinen Teil dazu beigetragen, die Theorie populär zu machen.

Eine weite, leere Landschaft bei Zossen in Brandenburg, südlich von Berlin. Auf einer Wiese ist ein Feld mit einem Drahtzaun abgesperrt. Es ist ein trüber Tag Anfang Herbst, zwei Dutzend Menschen stehen unter einem Zelt und ein paar Regenschirmen. Auf dem Feld steht in Gummistiefeln die Frau, wegen der alle hier sind: Barbara Ertel. Sie redet viel. Häufiger verpasst sie bei ihren Vorträgen den Moment, wenn hinter ihr ein neuer Hund auf das Feld geführt wird, um von ihr „eingeschätzt“ zu werden, obwohl das ein ganz entscheidender Augenblick sein soll. Eine ihrer vielen Helferinnen versucht dann, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das gelingt nicht immer sofort.
In der einen Hand hält Barbara Ertel eine Zigarette, in der anderen einen großen Becher Kaffee. Sie beobachtet, wie der Hund, den es „einzuschätzen“ gilt, über die Wiese stromert, wie er läuft und schnüffelt, wie er auf sie und die anderen Menschen reagiert. Manchmal hockt sie sich hin und redet mit den Tieren. Danach erzählt sie auch den Menschen, welche Stellung sie in einem Hund erkennt.
Um das zu überprüfen, werden nun andere Hunde aufs Feld geführt, deren Position schon früher bestimmt wurde. Angeblich erkennen die Hunde die Stellung der anderen – und verhalten sich entsprechend, woraus Barbara Ertel dann schließt, ob ihre Vermutung richtig war. „Ich bestätige Einschätzung“, ruft sie dann, fürs Protokoll und für die Videoaufnahme – alles wird gefilmt und später im Internet-Forum des Rudelstellungen-Vereins veröffentlicht. Schließlich bekommt der Hundebesitzer ein buntes Stück laminiertes Papier, auf dem die so ermittelte Stellung steht.
100 Euro kostet die Teilnahme an so einem Workshop pro Mensch; 50 Euro pro Hund. Der Tag beginnt mit einer Theorie-Stunde. Barbara Ertel steht in einem Zelt und hält einen Vortrag, ein Beamer wirft Folien an eine Leinwand. Groß an der Wand hängt so etwas wie das Glaubensbekenntnis der Szene. Das allgegenwärtige Schema zeigt die sieben Positionen, aus denen ein perfektes Hunderudel bestehen soll, die beiden Teilrudel. Pfeile deuten die Beziehungen untereinander an. Es gibt einen „Vorrang-Leithund“ ganz vorne, einen „Nachrang- Leithund“ am Ende, in der Mitte einen „Mittleren Bindehund“, dazwischen jeweils zwei „Bindehunde“.

In ihrem Buch schreibt Barbara Ertel:
„Das Wissen um die Geburtsstellung ist die zum Verständnis des Seelenlebens des Hundes notwendige Basis, auf der seine Gemeinschaftsfähigkeit beruht.“
„Sieben Teile sind ein perfekter Hund“, sagt Barbara Ertel. „Hunde sind Beamte: Alles ist geregelt und in Ritualen festgelegt.“ Für ihre Anhänger ist diese Position in der „Staatsstruktur“ entscheidend, um das Verhalten von Hunden zu erklären. Sie betrachten und interpretieren jedes Verhalten durch diese Brille.
In Gesprächen am Rande des Workshops und in den Diskussionen auf der Internetseite von Ertels Verein wird über Hunde manchmal kaum noch anhand ihrer Namen gesprochen, sondern bloß mit den Kürzeln ihrer angeblichen Stellung: Der Vorrang-Leithund ist der VLH, es folgen V2 und V3, der Mittlere Bindehund MBH, N2 und N3 und schließlich der Nachrang-Leithund NLH. „Einen schönen N2, den du dir da geholt hast“, ruft Ertel etwa einer Frau zu oder fragt: „Kennt Heikes MBH deinen V3?“
Barbara Ertel sagt: „Hier geht es nicht um Hokuspokus.“ Die Stellung eines Hundes zu kennen, sei nicht wie das Sternzeichen für sein Horoskop zu wissen. Mit Esoterik will sie nichts zu tun haben. Aber sie sagt auch den Satz: „Realität braucht keinen wissenschaftlichen Nachweis.“
Dass die Theorie stimmt, könne man einfach sehen, meinen ihre Anhänger. Ertel erzählt von „Spontanheilungen“ zum Beispiel bei Hunden mit Epilepsie, nachdem sie aus der „unpassenden“ Kombination von Stellungen befreit wurden.

Der Workshop verläuft an diesem Tag nicht ganz harmonisch. Eine Frau ist mit ihrem American Akita und ihrem Basset gekommen. Es handelt sich, wie sich herausstellt, um einen Vorrang-Leithund und einen Nachrang-Leithund, die laut Barbara Ertel unbedingt zu trennen wären. Die Besitzerin zeigt einen gewissen Widerwillen, das als unumstößliche Tatsache zu akzeptieren. Während die Hundehalterin noch auf der Wiese steht, hat Ertel sie längst abgeschrieben. Ein paar Meter von ihr entfernt erzählt sie den anderen Workshop-Teilnehmern achselzuckend, dass es immer solche Leute gebe, die es nie verstehen würden.
Ein Ehepaar, das schon ein paar Tage zuvor gekommen war und erfuhr, dass es sich bei seinem Labrador um einen Nachrang-Leithund handelt, ist noch einmal wiedergekommen. Sie zweifeln, ob die Diagnose wirklich stimmen kann, und vor allem sind sie unsicher, was sie jetzt für ihr Leben mit dem Hund bedeutet. Frau Ertel meint, sie sollten nicht sie fragen, sondern den Hund.

Zu den Besonderheiten der Kommunikation in dieser Welt gehört die Art, wie die Halter mit ihren Hunden reden – nicht mit Kommandos, sondern in ganzen Sätzen. „Einfach immer die Realitäten eins zu eins ganz klar mit dem Hund besprechen“, empfiehlt Barbara Ertel. Einer schwangeren Frau sagt sie, sie solle ihrem Hund erklären: „Ich bin schwanger, kann sein, dass ich manchmal in anderen Stimmungen bin als früher, aber das geht dich nichts an, ich bin ein Mensch.“
Einem kleinen Mischling, der sie wild ankläfft, sagt sie ruhig, sie fände das albern und er könne das lassen, sie habe ihn durchschaut. Dann lässt sie Tyson kommen, einen NLH, der dem mutmaßlichen N3 erklären soll, was Sache ist. „Tyson, hilfst du mir mal?“, ruft Ertel. „Kannst du das bitte mal abstellen? Und der soll auch nicht die Menschen anbellen, sag ihm das auch mal. Das geht überhaupt nicht. Komm, Tyson, mach das mal.“ Tyson hat nicht so richtig Lust.
Einen Teil der Zeit, in der sie die Hunde „einschätzt“, verbringt Ertel in einer Art Gespräch mit den Tieren: „Ich bin übrigens Barbara. Und wer bist du? Darf ich in deine Nähe kommen, ja? Das ist aber nett, dass du dich zu mir wendest. Die Menschen gucken dich immer an hier. Dann erklär ich den Menschen irgendwas über ihre Hunde, was ich sehe. Manchmal sehe ich’s richtig. Manchmal hab ich mich auch schon getäuscht.“
Für eine Theorie, der jeder wissenschaftliche Beweis fehlt und die ausschließlich darauf zurückgeht, was Ertel als sehr junge Frau vor 45 Jahren von einem einzelnen Züchter namens Karl Werner mündlich überliefert bekommen haben will, trifft die „Rudelstellung“ erstaunlich konkrete und kategorische Aussagen. „Hunde sollten prinzipiell nur dann Kontakt zueinander bekommen, wenn ihre Stellungen zueinander passen“, schreibt Barbara Ertel in dem Buch, in dem sie die Grundlagen ihrer Theorie erläutert, und führt dann detailliert aus, welche Kombinationen problematisch sind, je nachdem, ob der Hund „in Struktur lebt“ – also nach eben jenen Regeln gehalten wird. Schon Welpen sollten weder bewusst noch zufällig „mit Hunden in Kontakt kommen, deren Stellungen nicht passen“.
Überhaupt, die Welpen! Die müssen bereits in den ersten Lebenstagen entsprechend ihrer angeborenen Stellung hart arbeiten. Alle Welpen müssen zum Beispiel gemeinsam dafür sorgen, dass sich der Vorrang-Leithund VLH zum Schlafen nicht zwischen sie legt, sondern sich absondert. Hat er den Mut dazu aufgebracht, wird er nach einem Tag vom MBH abgeholt und von den Hundebabys wieder im Rudel aufgenommen. Meint Barbara Ertel.
Der britische Biologe John Bradshaw, der seit über 25 Jahren das Verhalten von Hunden und Katzen erforscht und Autor des Buches „Hundeverstand“ ist, hat eine klare Meinung zur vererbten Rudelstellung: „Mir fällt keine wissenschaftliche Erkenntnis ein, die eine solche These unterstützen würde.“ Er nennt sie einen „Kult“ und zählt einige der offenkundigen Haken auf:
„Es ist nachgewiesen worden, dass das Verhalten von Welpen in ihren ersten acht Lebenswochen (und ganz sicher in ihrer ersten Woche) keinerlei Aufschluss darüber gibt, wie sich jedes Individuum als ausgewachsener Hund verhält. Es hängt so sehr von den Erfahrungen ab, die der Hund in seinem neuen Zuhause macht.“
„Es gibt keine vorbestimmten ‘Rudelpositionen’, nicht sieben und auch keine andere Zahl. Hunde erarbeiten sich ihre Beziehungen zueinander, und diese können (und sollten) durch Training beeinflusst werden, um einen harmonischen Haushalt herzustellen.“
„Es konnte kein Zusammenhang festgestellt werden zwischen der DNA und der Wahrscheinlichkeit, dass ein Hund (oder irgendein anderes Tier) sich mit einem anderen versteht.“

Die Ablehnung der „Rudelstellung“-Theorie durch die Wissenschaft und bekannte Hunde- oder Wolfsforscher ist einhellig. Auf „Rudelstellungen klargestellt“, einer Seite von Kritikern, sagt Günther Bloch: Keiner der Genetiker, Zoologen, Ethologen oder Biologen, die er kenne, sei von der These der vererbten Stellung überzeugt, „weil bislang weder die Stammesgeschichte von Kaniden noch deren Verhaltensbiologie irgendwelche Hinweise erbracht hat, die diese Behauptung auch nur ansatzweise glaubhaft macht“. Stattdessen gebe es „jede Menge handfeste Belege, die das Gegenteil beweisen“.
Auch die Verhaltensforscherin und Tierschützerin Dorit Feddersen- Petersen lehnt die „Hundeeinschätzung“, wie sie Barbara Ertel betreibt, entschieden ab. Die Kernannahmen der „Rudelstellung“- Theorie hält sie für abwegig: „Es gibt unter Haushunden keine Eck- oder Leithunde oder Bindehunde mit immer wieder ganz speziellen Fähigkeiten / Aufgaben im Rudel.“ Auch der Gedanke, dass Hunde mit bestimmten Positionen die Funktion hätten, menschliche Anweisungen an andere Hunde im Rudel weiterzugeben oder zu übersetzen, sei abwegig: „Das ist Menschenwerk, erdacht, um die Hundeszene zu verblüffen, freundlich ausgedrückt.“
Doch je einhelliger und massiver die Ablehnung ausfällt, umso größer scheint der Glaube bei den Anhängern an die Richtigkeit ihrer Theorie. Einzelne vergleichen die Reaktionen der Wissenschaft mit dem Widerstand gegen Galileo Galilei.
Auch Ertel sieht sich als Opfer eines korrupten wissenschaftlichen Systems, das sich dagegen wehrt, neue Gedanken zu akzeptieren. Auch aus wirtschaftlichen Motiven werde sie ausgegrenzt, weil inzwischen ganze Geschäftsmodelle rund um das Training mit Hunden florieren: „Trainerpersönlichkeiten, die sind ja heute in der Rangordnung wie Schauspieler“, sagt sie. „Das ist krank.“ Einen Teil der Anfeindungen führt sie zurück auf persönliche Auseinandersetzungen und Kränkungen.
Als sie vor ein paar Jahren merkte, dass fast niemand ihr Wissen, das sie Ende der sechziger Jahren erworben habe, teilt, habe sie den Kontakt zu Wissenschaftlern gesucht, um das gemeinsam zu erforschen. Sie habe nie Antwort bekommen. Heute fühlen sich die „Rudelstellung“-Anhänger geradezu verfolgt von Kritikern. Unterstützer im wissenschaftlichen Bereich würden angefeindet und jeder Versuch, Forschung zu betreiben, attackiert.
„Mein Ziel ist es nicht, wissenschaftliche Anerkennung zu finden“, sagt Barbara Ertel, „ich brauche das nicht.“ Aber sie möchte, dass das, was sie als ihr Wissen um die Rudelstellung ansieht, nicht mit ihr stirbt. „Wenn ich gehe, möchte ich, dass jeder, der wirklich an Hunden Interesse hat, mithilfe einer Speichelprobe überprüfen kann, welche Stellung ein Hund hat.“
Deshalb werden von allen Hunden, die zu den Workshops kommen, DNA-Proben genommen. In denen suchten Genetiker dann nach Korrelationen mit der angeblichen Stellung der Hunde, wie sie Barbara Ertel eingeschätzt hat. Angeblich sollen erste, grobe Übereinstimmungen entdeckt worden sein.
Überprüfen lässt sich das nicht. Das, was man weiß, widerspricht nach Ansicht von Verhaltensforschern guter wissenschaftlicher Praxis.
Die Forschung soll von einem Genetiker der Universität Kiel durchgeführt werden, allerdings in seiner Freizeit – und nach Druck auf die Universität eher im Verborgenen. Anders als die Tierforscher, die alle abgewunken hätten, habe eine andere Gruppe von Wissenschaftlern großes Interesse an diesen Untersuchungen, sagt Barbara Ertel: Gerichtspathologen. Die würden sich von der Erforschung auch Rückschlüsse auf den Menschen versprechen. „Wenn es Struktur bei Hunden gibt und Aggression an einer bestimmten Stelle in der DNA liegt und der An- und Ausschalter an einer anderen, ist es vielleicht auch angelegt bei Kriminellen, die nicht resozialisierungsfähig sind und in richtigen Gewaltverbrechen ausarten.“
Sie sagt über die Pathologen: „Das sind verrückte Leute. Aber jetzt positiv.“ Man möchte sich nicht ausmalen, was sich diese Leute ausmalen, was aus dieser Forschung alles erwachsen könnte.
Wie kontrovers die Sache ist, ahnt man nicht, wenn man das ZDF sieht. Dort behandelt Maike Maja Nowak als „Hundeflüsterin“ Problemfälle. Darin propagiert sie auch die Lehren der Rudelstellung – die Hunde aus den Sendungen wurden teilweise, ohne dass es erwähnt wurde, von Barbara Ertel „eingeschätzt“.
Auf der Homepage zur Sendung heißt es, „Rudelstellungen“ spielten „in der Arbeit unserer Hundeflüsterin Maja Nowak eine zentrale Rolle“. Ein interaktives Schaubild und ein Erklärtext verbreiten unreflektiert die Thesen und deklarieren zum Beispiel: „Die Geburtsstellung überlagert alle anderen Merkmale wie Rasse, Geschlecht, Begabungen und Charakter.“
Auch auf kritische Nachfrage von Zuschauern blieb das ZDF bei seiner Darstellung. Die Zuschauerredaktion antwortete einer aufgebrachten Journalistin und Zuschauerin unbeirrt:
„So wie jeder Mensch eine andere Rolle und Funktion in unserer Gesellschaft einnimmt, kann das auch bei einem Hund sein. Die Funktion, die ein Hund im Rudel übernimmt, prägt seinen Charakter meist entscheidend. Daher ist die Rudelstellung ein wichtiger Faktor, der bei der Hundeerziehung berücksichtigt werden sollte.“
Auf eine andere Nachfrage erklärte das ZDF:
„Wir haben zu keinem Zeitpunkt den Anspruch vertreten, wissenschaftliche Erkenntnisse zu präsentieren, weder im Internet, noch in unserer TV-Reihe.“
ZDF-„Hundeflüsterin“ Maike Maja Nowak selbst hat sich inzwischen weitgehend von den Vorgaben und Lehren der „Rudelstellung“-Szene rund um Barbara Ertel distanziert. Im Oktober veröffentlichte sie auf ihrer Homepage ein „Resümee“, in dem es hieß:
„Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich die Einschränkungen die Barbara Ertel mit den Rudelstellungen für die Hunde und Halter in die Welt bringt, nicht teile. (…)
Ich vertrete weder die Art mit Menschen umzugehen, noch die Interpretationen, die in diesem Vereinsraum getroffen und diktatorisch aufrecht erhalten werden. Ich bin weder der Meinung, dass jeder Hund mit einem Hund vergesellschaftet werden sollte, noch dass Menschen keine guten Beziehungen zu ihrem Hund haben können, oder Hunde getrennt werden sollen, die sich tatsächlich gut verstehen.“
(Inzwischen hat Nowak dieses „Resümee“ wieder überarbeitet.)
Es ist nicht das erste Mal, dass sich Weggefährten von Barbara Ertel von ihr abwenden. Sie selbst sieht sich dadurch eher noch bestärkt, dogmatisch zu bleiben – die anderen seien überfordert gewesen oder hätten versucht, ihre Erkenntnisse zu missbrauchen, um ein eigenes Geschäftsmodell darauf aufzubauen oder die Hunde am Ende doch wieder durch Konditionierung zu brechen. „Bei mir gibt’s nicht ein bisschen Rudelstellung“, sagt sie. „Ich bin das Original.“
Sie setzt darauf, dass ihre Anhängerinnen selbst ihr Werk fortsetzen und durch gemeinsames Üben auch die Kunst der „Einschätzung“ von Hunden erlernen. Zu dem Verein, den sie gegründet hat, soll noch eine Stiftung hinzukommen.
Gemeinsam tauschen sie sich im Forum über das aus, was sie auf den Videos von den Einschätzungen sehen, führen Tagebücher über das Leben „in Struktur“, suchen gegenseitig Stellungspartner für ihre Hunde, planen die Verpartnerung der passenden Positionen, um das perfekte Rudel aufzubauen.
Die Hamburger Fachtierärztin für Verhaltenskunde und Tierschutz Barbara Schöning sagt, sie habe vor zwei Jahren zum ersten Mal von der Rudelstellungs-Theorie gehört – und es zunächst als bloße Spinnerei abgetan: Die Leute würden klug genug sein, nicht darauf reinzufallen. Im vergangenen Jahr habe die Zahl der Menschen, die sie darauf ansprechen, aber „extrem zugenommen“.
Aber was ist so attraktiv an dieser Lehre? Vielleicht liegt es daran, dass sie eine Art ganzheitlichen Ansatz verspricht, der größtmögliche Gegensatz zu dem, was etwa der bekannte Fernseh-Hundecoach Martin Rütter propagiert, der stark auf Konditionierung setzt und die meisten Probleme dadurch zu lösen scheint, dass er die Hunde durch das Werfen von Bällen und Futterbeuteln ablenkt und trainiert. Die Rudelstellung verspricht im Gegensatz dazu, das Innerste des Hundes zu erkennen und ihm gerecht zu werden.
Barbara Schöning sieht aber noch andere, sehr elementare Anziehungskräfte: „Es ist eine sehr einfache Theorie, und die Menschen lieben einfache Dinge. Sie lieben Rituale, die machen das Leben leichter.“ Die „Rudelstellung“ verlagere die Frage, wer Schuld ist, wenn etwas schiefläuft im Zusammenleben mit dem Hund, vom Menschen und seinem Verhalten auf das Tier, das einfach aufgrund einer angeblichen genetischen Veranlagung nicht passt.
In all den Forschungen über wild lebende Hunde in der Welt sei „nichts von angeborenen Positionen in einem Rudel zu finden“, sagt Schöning. „Keine der Arbeiten hat gezeigt, dass es genetisch fixierte Positionen gibt.“ Die Annahmen, die der Rudelstellungslehre zugrunde liegen, seien nicht nur nicht bewiesen, „sondern was wir wissen, geht auch noch in eine ganz andere Richtung. Deshalb lautet die Prognose: Sie wird auch nie bewiesen werden.“
Die Gesellschaft für Tierverhaltensmedizin und -therapie GTVMT, deren Vorsitzende sie ist, hat im September eine Stellungnahme veröffentlicht. Darin betont sie die dubiose Entstehungsgeschichte der Theorie:
„Das Konzept soll von einem Gärtnermeister (und Hundezüchter) bzw. in seiner Familie entwickelt und seit dem 19. Jahrhundert tradiert worden sein. Dieser Gärtnermeister soll sein Wissen dann an die eine Person weitergegeben haben, die es heute in Deutschland propagiert und dazu Einschätzungsseminare anbietet.“
Der Vorstand der GTVMT warne davor,
„die Lebensbedingungen und den Umgang mit einem Hund (z.B. auch die Entscheidung über Trainingsmethoden) pauschal von einer derartigen Einschätzung abhängig zu machen. Informationen aus dem Internet, wonach es Tauschbörsen für „nicht passende“ Hunde gibt, stimmen bedenklich. Die Verunsicherung von Besitzern, denen suggeriert wird, dass sie einen „falschen“ Hund haben, kann zu negativen bis hin zu tierschutzrelevanten Folgekonsequenzen für Hunde führen.“

Barbara Ertel ist keine Hundetrainerin. Sie hatte einen Hof mit Pferdezucht und ist mit einer eigenen Kollektion von Strickmode durchs Land gefahren. Später war sie viel in Andalusien, wo die Frauen in Dorfkooperativen zu Hause ihre Mode strickten. Ihre Hunde, sagt sie, waren einfach immer dabei, aber sie standen nicht im Mittelpunkt. Das Wissen, das sie von Karl Werner bekommen habe, habe sie begleitet und im Alltag immer wieder angewendet; mehr aber auch nicht.
Sie habe nie mit einem Hund etwas „geübt“, sagt Barbara Ertel, und habe noch heute das größte Problem mit der „Eingrenzung“ von Hunden. Durch Konditionierung würden Hunde „funktionabel“ gemacht, aber im Inneren gebrochen. „Die tun niemandem was, aber das sind für mich psychische Krüppel.“ Wo sie hinsieht, sieht sie nicht mehr „Struktur“, sondern „kaputte“ Hunde.
Erst vor wenigen Jahren, im Hundeforum „Polarchat“, hat sie bemerkt, wie außergewöhnlich ihr Blick auf die Hunde war – und wie irreführend und falsch, aus ihrer Sicht, die Empfehlungen waren, die die versammelten Experten für Probleme gaben. Ertel veröffentlichte ihren Widerspruch, es gab Krach. „Ich habe nicht auf die Kritiker gehört“, sagt sie. „Ich bin wie eine Bulldogge durch den Busch gegangen und habe mich dann umgesehen und festgestellt, dass einige Leute hängen geblieben.“
Mit denen arbeitet sie seitdem daran, ihr Wissen in der Welt zu behalten. Zwei- bis dreitausend Hunde hat sie inzwischen eingeschätzt, vermutet sie. „Es ist überhaupt nicht meine Intention, Menschen zu beglücken oder zufriedener zu machen“, sagt sie. „Ich mag Hunde und ich sag einfach nur: Seid anständig zu ihnen, und wenn ihr es nicht könnt, kann ich euch nicht verändern, aber dann wisst ihr wenigstens, was für eine Schweinerei ihr begeht.“
Mit dieser Haltung begegnet sie auch den Menschen beim Workshop. Sie sagt ihnen nicht, dass sie ihre vermeintlich unpassenden Hunde abgeben müssen. Sie lässt sie nur spüren, was sie ihren Hunden angeblich antun, wenn sie es nicht tun.
Ich habe Glück gehabt. Mein Hund Bambam, ein fünfjähriger Husky- Schnauzer-Mischling, ist laut Einschätzung von Barbara Ertel ein Vorrang-Leithund, und einen VLH kann man auch nach ihrer Lehre alleine, ohne andere Hunde halten.

Die „Gegenschätzung“ mit mehreren V2 gestaltete sich allerdings schwierig, weil Bambam feststellen musste, dass sich außer ihm niemand mit der gebotenen Gründlichkeit um die Mauselöcher auf dem Platz gekümmert hatte. Und das ging, wie üblich bei ihm, einfach vor.