Die Geschichte ist ein Traum: Ein junger Mann aus der Provinz erfindet ein Programm, auf das die Welt gewartet hat. Eltern können damit endlich nachgucken, was ihre Kinder wirklich an Computerspielen auf ihren Rechnern installiert haben, und die bösen oder nicht altersgerechten Sachen mit einem Mausklick von der Festpatte löschen lassen.

Der Held muss natürlich, wie es in solchen Geschichten ist, erst gewaltige Widerstände überwinden. Keiner will ihm helfen, viele verstehen ihn nicht. Die Sache schleppt sich über Jahre hin und kostet ein kleines Vermögen. Aber seine Familie steht ihm bei, und am Ende hat er geschafft und eine Software auf den Markt gebracht, die die Welt ein bisschen besser macht.
Die Leute von „Stern TV“ erzählen diese Geschichte in ihrer Sendung am 9. Juni ungetrübt von jeder journalistischen Distanz. Es ist ein insgesamt fast 18-minütiger redaktioneller Werbeblock für das Programm namens „Neoguard 2010“. Günther Jauch moderiert es an als eine „bemerkenswerte Entwicklung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und zum Aufatmen der besorgten Eltern“. Der Filmemacher Peter Schran hat den Programmierer Stefan Stein über längere Zeit begleitet und schwärmt von dessen „Vision“: „die fortschreitende Macht digitaler Monster in den Kinderzimmern bändigen“. Der Off-Sprecher sagt:
Es klingt nach der lang ersehnten Superwaffe für leidgeprüfte Eltern. Nur eine CD einlegen, zwei, drei Eingaben und die verbotenen Spiele werden enttarnt.
Dem „Tüftlersohn“, dessen Mutter als Sozialpädagogin an einer Hauptschule täglich mit der Problematik konfrontiert werde, fehlt es nicht an Selbstbewusstsein: Er führt vor, wie leicht die vermeintliche Jugendschutz-Sperre an der X-Box zu überlisten sei, und erklärt, dass sein eigenes Programm nicht so einfach zu knacken sein werde. Weltweit gebe es kein ähnliches System – wenigstens sei ihm keines bekannt. Als das Bundesfamilienministerium seine Bitte um Hilfe ablehnt, klagt er: „Ich blick nicht, warum die Leute nicht verstehen, was ihnen da an die Hand gegeben werden könnte.“
Im Studio lässt sich Günther Jauch von Stefan Stein vorführen, wie leicht die Software zu bedienen ist – und wie gut sie angeblich funktioniert. Bei einem Test findet sie zwar nur neun von zehn Spielen, die die Redaktion installiert hatte, aber das sei „ein Superergebnis“, findet Jauch. 25 Euro soll das Programm kosten, aber die Redaktion von „Stern TV“ hat für ihre Zuschauer noch ein Zusatzangebot: Kostenlos lässt sich auf der Sendungsseite im Internet eine eigene, abgespeckte Version herunterladen. Sie nennt sich „Stern-TV Spiele-Scanner“, trägt unübersehbar das bekannte Logo und kann zwar die gefundenen Programme nicht löschen oder namentlich auflisten, aber sie zählen.
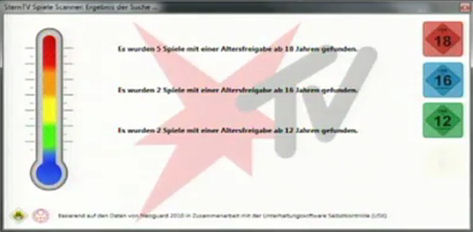
Jauch erklärt den Zuschauern:
„Das heißt, Sie können dann zu Ihrem Kind gehen und sagen: Pass mal auf, du hast die hier installiert, was sind das für Spiele, was machst du damit, mach die bitte weg etc. Und wenn Sie dann dem Kind am Ende nicht glauben oder wenn das sozusagen sich dauernd wiederholt, dann, würde ich sagen, nehmen wir [Stefan Steins] Luxus-Software und dann können Sie selber gucken, können’s löschen und kriegen’s dann vor allen Dingen sauber aufgeführt, wie diese ganzen Spiele heißen.“
Offenkundig erwartet die Redaktion einen größeren Ansturm auf das von ihr als Wunderwaffe dargestellte kostenlose Produkt. Jauch sagt:
„Machen Sie sich keine Sorgen, wenn das jetzt in der Nacht zusammenbricht. Das ist lang genug auf unserer Seite drauf, die nächsten Tage und Wochen auch.“
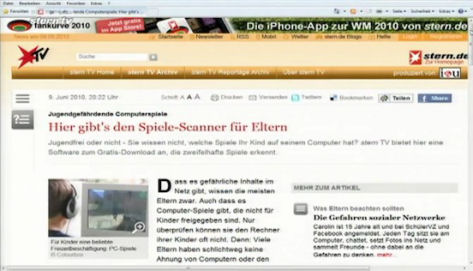
Der junge Mann werde in der Redaktion der „Killer-Spiel-Killer“ genannt, verrät Jauch. „Das ist ’ne tolle Idee“, sagt er noch zu ihm. „Herzlichen Glückwunsch!“
Die Reaktionen unter vielen Computerspielern waren deutlich weniger euphorisch, dafür aber häufig amüsiert. Einer nach dem anderen prahlte in einschlägigen Foren, wie viele der bei ihm installierten Spiele das vermeintliche Wunderprogramm nicht fand. Innerhalb kürzester Zeit hatten die Profis dokumentiert, wie lücken- und fehlerhaft die Datenbank mit den Spielen und ihren Altersfreigaben sei, und wie kinderleicht sogar der grundsätzliche Mechanismus des Programms überlistet werden könne. Kaum eine Behauptung der Hersteller hielt einer Überprüfung stand. Auch die Redaktion der Zeitschrift „PC Games“ berichtete auf ihrer Internetseite am Tag nach der „Stern TV“-Sendung von „ernüchternden Ergebnissen“.
Die Nachrichtenagentur epd und andere Medien hingegen sprang ungefähr gleichzeitig auf den Werbezug auf. „Der Killerspiele-Killer fürs Kinderzimmer – Ein neues Programm kann jugendgefährdende Spiele auf dem PC finden und löschen“, lautet die Überschrift eines längeren epd-Berichts. Er erzählte ebenfalls die Entwicklung des Programms als langjährige Heldengeschichte – hier kostete die Entwicklung sogar „knapp 100.000 Euro“. Bei „Stern TV“ war nur von 60.000 bis 70.000 Euro die Rede gewesen. Im epd-Bericht erhielt das Produkt zudem prominente Unterstützung: die Sprecherin des Aktionsbündnisses Amoklauf Winnenden sagte, das Programm sei die einzige (!) Möglichkeit, gegen altersindizierte Spiele aus dem Internet vorzugehen.
Auch Bild.de war begeistert:
Dass darauf nicht schon längst jemand gekommen ist: Eine neue Software kann jugendgefährdende Spiele auf dem PC finden und löschen. „Neoguard 2010“ verbannt so „Killerspiele“ aus dem Kinderzimmer. Der 28-jährige Hagener Stefan Stein hat das Programm entwickelt. Die Anwendung: kinderleicht!
Doch wer die überall angegebene Internet-Adresse aufruft, unter der das Zauberwerkzeug zu beziehen sein soll, findet heute nur eine leere Seite; auch die Homepage der Firma ist verschwunden. Der Server sei massiven Attacken ausgesetzt gewesen, sagt Stefan Stein auf Nachfrage. Und jetzt arbeite er mit einem Team erst einmal an einer neuen, erweiterten Version der Software, bei der auch ein „technisches Problem“ ausgeräumt werden soll, das aufgetreten sei, und wolle sich dabei keinen zu engen Zeitrahmen setzen. Nach den Sommerferien sei „Neoguard“ vermutlich verfügbar. Zu den akribisch dokumentierten Vorwürfen, was alles an seinem Programm nicht funktioniere, will er sich „zum jetzigen Zeitpunkt“ nicht äußern. Auch auf die Frage, wie es eigentlich zu der erstaunlichen Kooperation mit „Stern TV“ kam, möchte er nicht antworten – das müsse man schon bei dem RTL-Magazin erfragen.
Dort ist man allerdings auch wortkarg, was das Thema angeht. Andreas Zaik, der Leiter der Sendung, erklärt „auf dem Weg ins Wochenende“ auf detaillierte Fragen nur kurz: „stern TV hat den „Spielescanner“ wegen technischer Probleme vorübergehend vom Netz genommen. Dies wird bis zu deren Klärung und Behebung auch so bleiben.“
Tatsächlich führen die Links auf die Seite mit dem Download ins Leere. Und auf der Archivseite der Sendung ist jeder Hinweis auf den sensationellen „Spiele-Scanner“ nachträglich beseitigt worden. Nach all der wortreichen Werbung für das Produkt schenkt „Stern TV“ seinen Zuschauern und all den Eltern, die hofften, einen Schlüssel zum Säubern des Computers ihrer Kinder gefunden zu haben (wenn sie sie überhaupt ins Zimmer lassen), nicht ein einziges Wort der Erklärung, warum das Programm mit einem Mal verschwunden ist.
Viele Fragen sind noch unbeantwortet. Aber es scheint, als wäre das Programm bestenfalls gut gemeint, aber in vielfacher Hinsicht ungeeignet, Kinder und Jugendliche von nicht altersgerechten Computerspielen fernzuhalten. Die Geschichte war wirklich ein Traum – für und von Journalisten.


 Müller-Hohensteins
Müller-Hohensteins  Vielleicht kann man da den ZDF-Chefredakteur verstehen, dass er nicht glücklich ist mit dieser Form der Nebentätigkeit seiner Star-Moderatorin (obwohl sie von seinem Vorgänger Nikolaus Brender genehmigt worden sein soll): „Ihr Internet-Auftritt auf den Seiten von Weihenstephan ist nicht glücklich und kann so nicht bleiben“, sagte er gegenüber dem „Medium Magazin“. Er sei „nicht grundsätzlich dagegen, dass Kollegen Nebentätigkeiten ausüben, solange sie keinen werblichen Charakter haben und die journalistische Glaubwürdigkeit nicht gefährden“ und regte neue Richtlinien für solche Fälle an.
Vielleicht kann man da den ZDF-Chefredakteur verstehen, dass er nicht glücklich ist mit dieser Form der Nebentätigkeit seiner Star-Moderatorin (obwohl sie von seinem Vorgänger Nikolaus Brender genehmigt worden sein soll): „Ihr Internet-Auftritt auf den Seiten von Weihenstephan ist nicht glücklich und kann so nicht bleiben“, sagte er gegenüber dem „Medium Magazin“. Er sei „nicht grundsätzlich dagegen, dass Kollegen Nebentätigkeiten ausüben, solange sie keinen werblichen Charakter haben und die journalistische Glaubwürdigkeit nicht gefährden“ und regte neue Richtlinien für solche Fälle an. Über die Frage, ob Menschen, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen an prominenter Stelle im weitesten Sinne als Journalisten arbeiten, auch noch Werbung machen sollten, kann man streiten. Und darüber, wie Gier jedes Gefühl für peinliche Auftritte auszuschalten scheint, staunen. Aber für dumm verkaufen lassen sollte man sich als Gebührenzahler von einer Katrin Müller-Hohenstein nicht müssen.
Über die Frage, ob Menschen, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen an prominenter Stelle im weitesten Sinne als Journalisten arbeiten, auch noch Werbung machen sollten, kann man streiten. Und darüber, wie Gier jedes Gefühl für peinliche Auftritte auszuschalten scheint, staunen. Aber für dumm verkaufen lassen sollte man sich als Gebührenzahler von einer Katrin Müller-Hohenstein nicht müssen.





 Klingt nach einer Selbstverständlichkeit. Ist es aber nicht. RTL hat sich zum Beispiel gerade richtig viel Mühe gegeben, die letzte Folge der Erstausstrahlung von „Der Lehrer“ vor dem Publikum zu verstecken. Und schaffte es, dass sie nicht, wie die anderen, von gut zwei Millionen Leuten gesehen wird, sondern nur von ein paaar Hunderttausend.
Klingt nach einer Selbstverständlichkeit. Ist es aber nicht. RTL hat sich zum Beispiel gerade richtig viel Mühe gegeben, die letzte Folge der Erstausstrahlung von „Der Lehrer“ vor dem Publikum zu verstecken. Und schaffte es, dass sie nicht, wie die anderen, von gut zwei Millionen Leuten gesehen wird, sondern nur von ein paaar Hunderttausend. Aber genau das ist es ja. RTL versendet gerade auch die komplette letzte Staffel der erfolgreichen und vielgelobten Serie „Mein Leben & ich“ zu einer Zeit, wo eh keiner guckt. Auch diese Comedy hing zunächst ein paar Jahre im Keller ab, bis der Sender vor einigen Wochen plötzlich und unangekündigt damit begann, sie in der Nacht von Freitag auf Samstag und im Morgengrauen am Sonntag zu verstecken – gerne in Doppelfolgen, in der jeweils zuerst die zweite Folge läuft und dann die erste.
Aber genau das ist es ja. RTL versendet gerade auch die komplette letzte Staffel der erfolgreichen und vielgelobten Serie „Mein Leben & ich“ zu einer Zeit, wo eh keiner guckt. Auch diese Comedy hing zunächst ein paar Jahre im Keller ab, bis der Sender vor einigen Wochen plötzlich und unangekündigt damit begann, sie in der Nacht von Freitag auf Samstag und im Morgengrauen am Sonntag zu verstecken – gerne in Doppelfolgen, in der jeweils zuerst die zweite Folge läuft und dann die erste.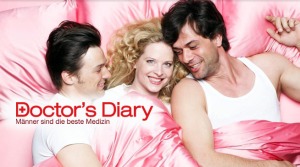 Wenn RTL wenigens konsequent wäre und die Nachtstrecke konsequent für die verbliebenen sehenswerten Programme verwenden würde – man könnte sich drauf einlassen und auf Verdacht den Rekorder programmieren. Neben versprengten Serienresten und der schönen Abschlussstaffel von „Mein Leben & ich“ hätte man so Ende November (natürlich ebenfalls unangekündigt) schön noch einmal „Doctor’s Diary“ sehen können, jeweils gegen 2 oder 3 Uhr. Und Vox ahmt es dem großen Bruder nach und hat in den vergangenen Tagen einfach mehrere bislang ausgelassene Folgen der amerikanischen Krimiserie „The Closer“ ausgestrahlt, eine am Montag, zwei im Doppelpack am Mittwoch, eine am Dienstag, aber immer gegen drei Uhr morgens.
Wenn RTL wenigens konsequent wäre und die Nachtstrecke konsequent für die verbliebenen sehenswerten Programme verwenden würde – man könnte sich drauf einlassen und auf Verdacht den Rekorder programmieren. Neben versprengten Serienresten und der schönen Abschlussstaffel von „Mein Leben & ich“ hätte man so Ende November (natürlich ebenfalls unangekündigt) schön noch einmal „Doctor’s Diary“ sehen können, jeweils gegen 2 oder 3 Uhr. Und Vox ahmt es dem großen Bruder nach und hat in den vergangenen Tagen einfach mehrere bislang ausgelassene Folgen der amerikanischen Krimiserie „The Closer“ ausgestrahlt, eine am Montag, zwei im Doppelpack am Mittwoch, eine am Dienstag, aber immer gegen drei Uhr morgens.
 Dass es trotzdem vergleichsweise angenehm war, ihr zuzuhören, lag auch daran, dass sie einfach vom Zettel ablas und nicht wie fast alle anderen vom Teleprompter. Beim Ablesen klangen die meisten der vermeintlichen Profis wie Kinder in der vierten Klasse, die sich so sehr auf das richtige Erfassen der Wörter konzentrieren, dass sie das, was sie da sagen, nicht gleichzeitig auch noch verstehen können. Besonder bizarr wirkte das bei den Scorpions, die zu dritt haarscharf an der Kamera vorbei auf die ihnen offenkundig fremden Buchstaben schauten und aussahen, als würden sie am liebsten ihre Finger über die Zeilen gleiten lassen, während sie schon damit überfordert waren, noch wie respektable Hardrocker auszusehen und dabei Shakira zu loben.
Dass es trotzdem vergleichsweise angenehm war, ihr zuzuhören, lag auch daran, dass sie einfach vom Zettel ablas und nicht wie fast alle anderen vom Teleprompter. Beim Ablesen klangen die meisten der vermeintlichen Profis wie Kinder in der vierten Klasse, die sich so sehr auf das richtige Erfassen der Wörter konzentrieren, dass sie das, was sie da sagen, nicht gleichzeitig auch noch verstehen können. Besonder bizarr wirkte das bei den Scorpions, die zu dritt haarscharf an der Kamera vorbei auf die ihnen offenkundig fremden Buchstaben schauten und aussahen, als würden sie am liebsten ihre Finger über die Zeilen gleiten lassen, während sie schon damit überfordert waren, noch wie respektable Hardrocker auszusehen und dabei Shakira zu loben.