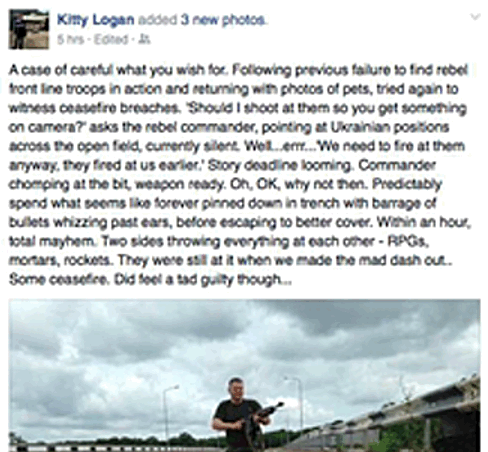Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Ich habe den Werbespot der FDP zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gesehen und will jetzt sofort Daniel Rosenthal wählen.
Der Berliner Fotograf hat Parteichef Christian Lindner beim Reden, Konferieren, Herumstehen, Rasieren, Im-Auto-Sitzen und Sich-die Augen-Reiben abgelichtet. Es sind fantastische Bilder geworden, die die FDP zu einem Film montiert hat. Sie zeigen Lindner in scheinbar privaten Momenten, und vermutlich muss man sie sich im Kino ansehen und nicht auf Youtube, um die maximale Wirkung dieser für die Öffentlichkeit inszenierten Privatheit zu erleben.
Es ist ein faszinierender Kontrast aus der scheinbar ungeschönten dokumentarischen Wirklichkeit in Schwarz-Weiß, die Lindner authentisch, verletzlich und real wirken lässt, und der großen Eitelkeit, die diese Inszenierung ausstrahlt. Der FDP-Chef im weißen T-Shirt nachdenklich auf einem Sofa, mutmaßlich im Hotel, das Mobiltelefon in beiden Händen – er könnte so auch für Calvin Klein werben.
Auf den meisten Fotos sieht er sehr müde aus. Vielleicht ist das die neue Art zu zeigen, dass sich ein Politiker aufreibt für die Menschen: Ihn nicht vor Kraft und Energie strotzend, dynamisch, stark darstellen. Sondern erschöpft, abgekämpft. Natürlich rennt Lindner am Ende trotzdem dynamisch ein paar Treppenstufen hinaus und spricht eindringlich zu Menschen, die ihm gebannt zuhören. Die Schlüsselszene, betont von der Musik und einer Schwarzblende, scheint der Moment zu sein, in dem Lindner sich im Spiegel einer öffentlichen Toilette selbst in die Augen guckt. Wenn die Müdigkeit und die Zweifel Christian Linder zu übermannen drohen, dann schaut Christian Lindner sich in die Augen und findet dort neue Kraft und Mut.
Es ist also ironischerweise nicht der Blick auf das Land und was dort alles zu tun ist oder die Begegnung mit Menschen, was Christian Lindner in dieser Dramaturgie letztlich motiviert. Viel zu wenige von uns erblicken beim Blick in den Spiegel einen Christian Lindner, der unsere innere Müdigkeit vertreibt.
Es ist ein faszinierender Werbespot, gewagt, anders, auffällig. Aber so überzeugend die Inszenierung Lindners als bis zur Erschöpfung arbeitender Widerstandskämpfer formal ist, so lächerlich wird sie, wenn man auf den Text hört. „Haben Sie mal was gemacht, von dem Sie überzeugt waren, dass es richtig ist?“, fragt Lindner aus dem Off – das ist auch der Titel des Videos. „Klar, dauernd, Sie etwa nicht?“, möchte man zurückrufen, aber natürlich meint Lindner etwas anderes, nämlich: Haben Sie mal was gemacht, von dem alle anderen überzeugt waren, dass es falsch ist?
Das attraktive Rebellen-Image Lindners entsteht aus dem behaupteten Widerstand, den der FDP-Mann für seine Positionen und Themen erfährt – angeblich muss er sich Kommentare anhören wie: „Warum sprecht ihr über Schulen? Rechtsstaat …“ (im Bild: der Kölner Hauptbahnhof) „… falsches Thema! Stau – Quatsch. Bürokratismus – interessiert keinen.“ Lustige Idee: Dass ein Politiker für verrückt erklärt wird, wenn er den Zustand der Schulen, die Silvesternacht in Köln oder den Stau zum Thema macht. Der Stau, das große verkannte Nischenthema unserer Zeit, über das sonst keiner zu sprechen wagt.
Außer Christian Lindner. Der deshalb müde ist. Sehr attraktiv müde.