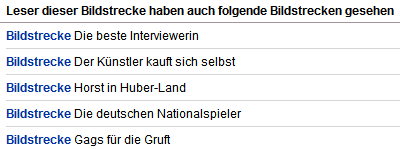Die „Huffington Post“ bietet Bloggern Aufmerksamkeit statt Geld, aber die Aufmerksamkeit, die sie bietet, muss die „Huffington Post“ auch erst selbst generieren. Sie tut das atemlos, pausenlos; die ganze Seite ist wie jemand, der schnipsend, winkend, johlend, Rad schlagend, mit Kaninchen jonglierend, mit gigantischen blinkenden Pfeilen auf sich zeigend vor einem steht.

Dies ist aktuell die Startseite, und zu sagen, dass das ungefähr der unattraktivste und am wenigsten heimelige Ort ist, den ich mir vorstellen kann, geht völlig am Thema vorbei. Die Seite sieht so aus, weil ihre Verantwortlichen wissen, dass genau diese überladene, bewegte, bunte, großbuchstabige Überforderung dafür sorgt, am meisten Aufmerksamkeit und Klicks zu generieren.
Im Inneren lärmt es genau so weiter. Jeder Pups wird zu einer dröhnend stinkenden Riesenflatulenz aufgeblasen. Dies war vor wenigen Minuten die Startseite des Medien-Ressorts:

Wer den Fehler macht, auf das spektakulär klingende Versprechen vom „TREFFEN MIT DEM FEIND“ zu klicken, kommt zu einem Geschichtlein, wonach ein konservativer Journalist auf Twitter erklärt hat, warum er an einem Hintergrundgespräch mit Präsident Obama teilgenommen hat, über dessen Inhalt er nichts sagen darf. Sechs Tweets, die praktisch keine Beachtung fanden, und in ihrer Einleitung dazu muss selbst die „Huffington Post“ zugeben, dass es fast keine Proteste aus der konservativen Ecke gab, für die der Mann sich überhaupt hätte rechtfertigen müssen. Aber eine Aufmachung, als hätte sich Obama mit dem Chef der Taliban getroffen.
Der Medienteil besteht sonst gerade aus:
- der Meldung, dass eine Korrespondentin CNN verlässt, was eine andere Seite gemeldet hat
- dem Gerücht, dass der Sohn der Schauspielerin Mia Farrow bei MSNBC anfangen könnte, was eine andere Zeitung gemeldet hat
- einigen Sätzen von Alec Baldwin, dass er zunächst gar nicht so scharf darauf war, für MSNBC zu arbeiten, was er einer anderen Seite gesagt hat
- einer Meldung über Einschaltquoten, die auf einer anderen Seite gestanden haben
- einem Video von einer Diskussion auf MSNBC
- einem Zitat aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk NPR
- einer AP-Meldung über Journalisten, die in Syrien festgehalten werden
- einer Meldung, dass die Berichterstattung über die Präsidentschaftswahl 2016 schon jetzt extrem umfassend ist, was eine Studie ergab
Hinter der vielversprechenden Schlagzeile „The Ultimate Example Of The Power Of The Press“ verbirgt sich eine Reuters-Meldung, wonach der iranische Verhandlungsführer im Atom-Streit sich über den Bericht einer Hardliner-Zeitung so sehr geärgert habe, dass er physische Schmerzen bekam und sich im Krankenhaus untersuchen ließ. Mit der Original-Überschrift der Nachrichtenagentur („Hardline newspaper report sends Iran foreign minister to hospital“) ist natürlich kein Blumentopf zu gewinnen.
Die Beobachtung, dass Obama bei einer Pressekonferenz nur Journalisten von kleineren Medien aufrief und nicht die großen, führt in der „Huffington Post“ zur nicht weiter erklärten Teaser-Zeile: „SHUT OUT“.
Und auch der (aus einem anderen Medium abgeschriebenen) Beobachtung, dass eine bekannte MSNBC-Journalistin bei einem Vortrag vor Studentinnen und Journalistinnen einer jungen Frau womöglich einen Kontakt zum Sender verschafft hat, verschafft die „Huffington Post“ die angemessene größtmögliche Beachtung.
Das wird alles, gemessen an Aufmerksamkeit, wunderbar funktionieren. Der designierte Chefredakteur der deutschen Ausgabe der „Huffington Post“, Sebastian Matthes, erzählt auch stolz, dass man im Redaktionssystem mehrere alternative Überschriften und Bebilderungen anlegen kann und dann sieht, welche besser geklickt und verlinkt wird.
Wenn man erfolgreich auf einen Artikel gelockt wurde, ist es damit natürlich nicht getan. Zu fast jedem Stück gehört eine Bildergalerie oder ein Video, locken Dutzende weitere Teaser, laden Symbole zum Twittern, E-Mailen, Teilen, Kommentieren ein. Ich soll den Autoren folgen, Themen abonnieren, Newsletter bestellen, das Ressort liken, es bei Reddit unterbringen, die regelmäßig vierstellige Zahl von Kommentaren zum Text lesen. Die ganze Seite brüllt: Mach mit! Tu was! Komm hierher! Schau hierüber! Klick das!
Das ist vermutlich vorbildlich und unzweifelhaft erfolgreich, gemessen an einer einzigen Währung: Aufmerksamkeit.
Die „Huffington Post“ ist Meister darin, Aufmerksamkeit zu generieren und sich von anderswo generierter Aufmerksamkeit einen möglichst großen Teil abzuzwacken. Die eigentlich entscheidende Frage, worauf diese Aufmerksamkeit gerichtet ist, tritt hinter der Frage, wie man sie steigern kann, völlig zurück. Aufmerksamkeit ist ein Wert an sich. Hey: Boris Becker, der Mann, von dem man wirklich schon lange nichts mehr gehört und gelesen hat, wird der erste Blogger der an diesem Donnerstag startenden „Huffington Post Deutschland“. Hurra!
Das kann man natürlich alles machen, das ist auch nicht der Sargnagel im deutschen Journalismus. Ich glaube nur, dass der hiesigen Medienlandschaft kaum etwas weniger gefehlt hat als eine solche Windmaschine. Es spricht viel dafür, dass die deutsche „Huffington Post“, wie ihr amerikanisches Vorbild, für Menschen, die guten Journalismus und einzigartige Inhalte suchen, ein eher unwirtlicher Ort wird.
Und dann ist es schon bemerkenswert, wie schwer sich selbst die „Huffington Post“ noch damit tut, die ganze Aufmerksamkeit, die sie erfolgreich generiert, in Geld umzuwandeln. Nach Berechnungen des „Handelsblatts“ schreibt sie international rote Zahlen. Auch Aufmerksamkeit ist eine Währung, die unter Inflation leidet.



 (A) Anke Engelke, Michel Friedman, Peter Scholl-Latour, Dt. Fernsehpreis
(A) Anke Engelke, Michel Friedman, Peter Scholl-Latour, Dt. Fernsehpreis (B) Georg Kofler
(B) Georg Kofler (C) Goldenem Panther, Bayerischer Fernsehpreis
(C) Goldenem Panther, Bayerischer Fernsehpreis (D) Stefan Aust
(D) Stefan Aust (E) Dirk Bach, Moderation Dt. Fernsehpreis
(E) Dirk Bach, Moderation Dt. Fernsehpreis